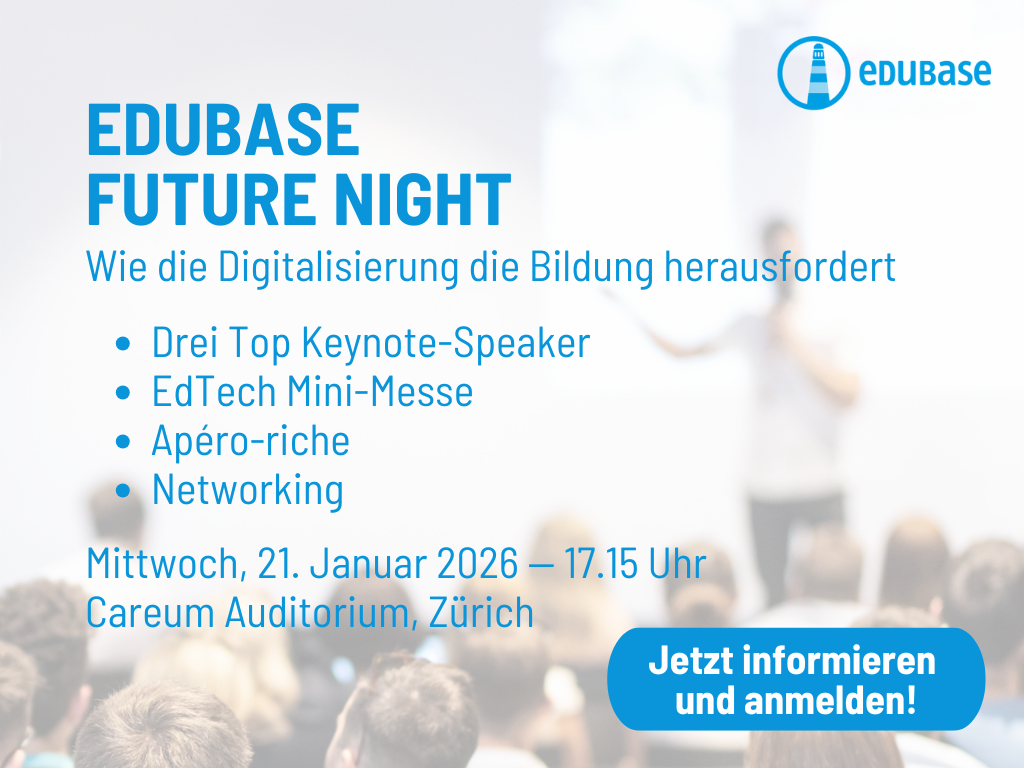Neues Buch im hep Verlag
Ausbildungsverbünde als Dienstleistungsanbieter
Ausbildungsverbünde ermöglichen Kooperationen zwischen Lehrbetrieben und bieten Dienstleistungen von der Rekrutierung bis zur strukturierten berufspraktischen Grundausbildung. Der vorliegende Beitrag skizziert Entstehung, Formen und Herausforderungen solcher Verbünde in der Schweiz. Die ursprünglich in Verbünde gesetzten Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, doch in Nischen können ihre Dienstleistungen eine wichtige Rolle spielen. Der Beitrag stützt sich auf qualitative Fallstudien und basiert auf dem 2024 im hep Verlag erschienenen Buch Ausbildungsverbünde.
1 Ausgangslage und Forschungsstand
Unter dem Dachbegriff «Ausbildungsverbünde» wird eine breite Palette von Arrangements gefasst – von gemeinsam koordinierten Lehrverhältnissen bis zur Auslagerung einzelner Ausbildungsteile.
Dual organisierte Berufsbildungssysteme sind darauf angewiesen, dass Betriebe Lernende ausbilden. Viele Unternehmen tun dies, weil sich die Ausbildung betriebswirtschaftlich lohnt – durch produktive Mitarbeit während der Lehre oder durch geringere Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten nach Abschluss. Gleichwohl bildet nur ein Teil der Betriebe aus; andere verzichten aus Kapazitäts-, Spezialisierungs- oder Aufwandsgründen (BMBF, 2024; Dornmayr, 2023; SKBF, 2023).
Als Antwort entstanden in der Schweiz, aber auch etwa in Deutschland oder Österreich, Kooperationen zwischen Lehrbetrieben. Unter dem Dachbegriff «Ausbildungsverbünde» wird eine breite Palette von Arrangements gefasst – von gemeinsam koordinierten Lehrverhältnissen bis zur Auslagerung einzelner Ausbildungsteile. Studien zeigen wiederkehrende Muster: Entstehungsschübe in Krisenzeiten, eine grosse Formenvielfalt, eine insgesamt begrenzte Verbreitung und die zentrale Rolle ökonomischer Motive auf Seiten der Betriebe (Ebbinghaus/Dionisius, 2020; Lachmayr, 2009; Leemann, 2019).
2 Entwicklung in der Schweiz
2.1 Die 1990er-Jahre: Anschub durch Lehrstellenbeschlüsse
Die konjunkturelle Krise der 1990er-Jahre führte zu ausserordentlichen Fördermitteln («Lehrstellenbeschlüsse»). Damit wurden Konzepte, Leitfäden und erste Verbünde finanziert (Gertsch, 1999). Aus dieser Phase stammen mehrere heute bekannte Akteure und Modelle – etwa grossbetriebliche Lehrwerkstätten, die für externe Betriebe geöffnet wurden (z.B. AZW, libs), sowie sparten- oder landesweit agierende Verbünde (z.B. login). Die Idee: durch Kooperation zusätzliche Lehrstellen schaffen und Ausbildungsqualität sichern.
2.2 Rechtsrahmen seit 2002 – und geringe Verbreitung
Lehrbetriebsverbünde haben sich weniger stark etabliert, als es sich die Berufsbildungspolitik ursprünglich erhofft hatte. Im Jahr 2024 entfielen lediglich 2,3 % aller Abschlüsse der beruflichen Grundbildung auf eine Ausbildung in einem Lehrbetriebsverbund.
Mit dem revidierten Berufsbildungsgesetz (BBG) und der Berufsbildungsverordnung (BBV) wurden Lehrbetriebsverbünde ausdrücklich verankert (Bundesrat, 2003, Art. 6 Abs. c; Bundesversammlung, 2002, Art. 16 Abs. 2a). Nebst dem Verbund erlauben die Bestimmungen Kettenlehrverträge (aufeinanderfolgende Lehrverträge in verschiedenen Betrieben) sowie – nicht explizit normiert, aber verbreitet – Ergänzungsausbildungen zwischen Betrieben. Mehrere Kantone schufen Förderinstrumente, andere verzichten darauf. So entstanden unterschiedliche kantonale Spielräume für Aufbau, Betrieb und Finanzierung von Verbünden.
Allerdings haben sich Lehrbetriebsverbünde weniger stark etabliert, als es sich die Berufsbildungspolitik ursprünglich erhofft hatte. Im Jahr 2024 entfielen lediglich 2,3 % aller Abschlüsse der beruflichen Grundbildung auf eine Ausbildung in einem Lehrbetriebsverbund (BFS, 2025).
3 Typen und Dienstleistungen
In der Praxis lassen sich Verbünde am besten über ihr Dienstleistungsprofil unterscheiden (Maurer et al., 2024):
- Dienstleistungen zur Realisierung von Lehrverhältnissen. Einholen von Bildungsbewilligungen, Lehrstellenmarketing und Rekrutierung, Lehrvertragsmanagement, überbetriebliche Koordination, Begleitung der Lernenden, Austauschformate und Anlässe.
- Ausbildungsdienstleistungen im engeren Sinn. Vor allem «Bildung in beruflicher Praxis» in einem Ausbildungszentrum, teils auch üK-Durchführung oder (in Ausnahmen) schulische Angebote. Zentrumsmodelle bündeln teure Infrastruktur, sichern Standardqualität und verkürzen Einarbeitungszeiten in den Betrieben.
- Leistungen jenseits der Grundbildung. Weiterbildungen für Berufsleute, Brückenangebote oder Coaching – häufig, um Infrastruktur und Personal besser auszulasten und Übergänge in Arbeit zu unterstützen.
4 Gegenwärtige Erscheinungsformen
A Lehrbetriebsverbünde mit Ausbildungszentrum
Dies sind meist eigenständige Organisationen (oft vereinsrechtlich), teils von wenigen Grossunternehmen oder Branchen getragen. Sie vermitteln betriebliche Grundkompetenzen zentral – je nach Beruf bis zu zwei Jahre – und übergeben die Lernenden danach an Verbundbetriebe. Das Modell ist in technisch-industriellen, pharmazeutischen und informatiknahen Berufen besonders verbreitet. Finanziell tragen sich diese Verbünde häufig über Beiträge der beteiligten Betriebe; öffentliche Mittel fliessen primär für üK oder gezielte Projekte.
B Lehrbetriebsverbünde ohne Ausbildungszentrum
Sie konzentrieren sich auf Administration, Koordination und Begleitung – insbesondere für KMU. Solche Verbünde sind häufiger öffentlich (mit-)finanziert, etwa um benachteiligte Jugendliche zu unterstützen oder internationale Unternehmen für die Ausbildung zu gewinnen. Ohne Subventionen bleiben sie meist klein und personell schlank; Wachstum ist anspruchsvoll, da die Zahlungsbereitschaft der Betriebe begrenzt ist.
C Kleinverbünde mit Betrieb als Leitorganisation
Dieses Modell – politisch lange favorisiert – ist in der Realität selten. Branchen, die es prüften (z.B. Forstwirtschaft), entschieden sich oft dagegen. Stattdessen etablierten sich Ergänzungsausbildungen als pragmatische Alternative: reziprok zwischen ähnlich ausbildenden Betrieben (etwa Hotel- oder Lebensmittelbetriebe) oder als punktuelle Ergänzung durch grössere für kleinere Betriebe. Diese Einsätze dauern meist Tage bis Wochen, werden häufig ohne formelle Entschädigung organisiert und sind stark vertrauensbasiert.
D Grossunternehmen und öffentliche Verwaltungen
Auch Grossunternehmen gelten als Lehrbetriebsverbund, wenn sie ihre Berufsbildung zentral koordinieren.
Auch Grossunternehmen gelten als Lehrbetriebsverbund, wenn sie ihre Berufsbildung zentral koordinieren. Um Mehrfachbewilligungen zu vermeiden und Rotationen zu ermöglichen, wählen sie häufig das Modell eines interkantonalen Verbunds. Auch öffentliche Verwaltungen organisieren ihre Berufsbildung teils in Verbünden, etwa die Städte Zürich und Winterthur. Vor allem aus diesem Grund schliessen verhältnismässig viele Lernende, die ihre Grundbildung in einem Verbund durchlaufen, mit einem EFZ als Kauffrau/Kaufmann ab.
E Kettenlehrverträge
Vor allem in der Landwirtschaft verbreitet, oft mit klar organisierten Abfolgen und einer Koordinationsstelle als faktischem «Leitorgan». Je nach Kanton wird alternativ ein Verbund ohne Zentrum genutzt; beide Varianten beruhen auf dem Prinzip, Lernorte systematisch zu wechseln.
5 Rotation in der Praxis
Die ursprünglich zentrale Idee der Rotation – regelmässige Wechsel zwischen spezialisierten Betrieben – hat sich ausserhalb spezifischer Kontexte nur begrenzt durchgesetzt. Viele Betriebe möchten Lernende länger halten, weil produktive Mitarbeit erst nach betriebs- und prozessspezifischer Einarbeitung möglich ist. Rotationen finden daher eher in folgender Form statt:
- kurz (z.B. dreimonatige Kurzrotationen),
- situativ (zur Vermeidung von Vertragsauflösungen),
- oder kontextgebunden (subventionierte Modelle, Landwirtschaft). Eine gezielte Breitenbildung wird häufiger über Zentren (Grundkompetenzen) oder Ergänzungsausbildungen erreicht als über systematische Jahresrotationen.
6 Fazit
6.1 Warum sind Verbünde so wenig verbreitet?
Zwei Perspektiven greifen ineinander:
- Ökonomik der Betriebe. Kooperation verursacht Koordinations-, Übergabe-, Einarbeitungs- und mitunter Opportunitätskosten. Die Erträge (Produktivität der Lernenden, Zugang zu passenden Bewerbenden, Qualitätssicherung) materialisieren sich je nach Beruf, Betriebsgrösse und Arbeitsorganisation unterschiedlich. Für viele KMU ist die Rechnung knapp – insbesondere, wenn sie auch ohne Verbund ausbilden dürfen.
- Regulatorik und Optionenraum. Heute können auch hoch spezialisierte Betriebe eine Bildungsbewilligung erhalten, sofern Mindestanforderungen (z.B. Qualifikation der Berufsbildenden, Verhältnis Fachkräfte/Lernende) erfüllt sind. Ältere Vorgaben, die fehlende Ausbildungsteile zwingend über Partner abdecken mussten, wurden gelockert. Damit entfällt ein regulatorischer Anreiz, sich einem Verbund anzuschliessen oder systematisch Ergänzungsausbildungen zu organisieren. Ergebnis: Verbünde konkurrieren mit der Option «wir bilden allein aus» – und setzen sich nur dort durch, wo ihr Leistungsversprechen einen klaren Mehrwert stiftet.
6.2 Einordnung
Verbünde schaffen nicht automatisch zusätzliche Lehrstellen, sie nehmen unterschiedliche Formen an und sind am erfolgreichsten, wenn sie klare Dienstleistungen mit erkennbarem Nutzen anbieten.
Die Schweizer Befunde bestätigen internationale Beobachtungen: Verbünde schaffen nicht automatisch zusätzliche Lehrstellen, sie nehmen unterschiedliche Formen an und sind am erfolgreichsten, wenn sie klare Dienstleistungen mit erkennbarem Nutzen anbieten. Besonders tragfähig sind Zentrumsmodelle, die Grundkompetenzen effizient und in konstanter Qualität vermitteln. Verbünde ohne Zentrum bestehen, wo öffentliche Ziele (Chancenausgleich, Abschlussquote Sek II, Internationalisierung) verfolgt werden oder wo Branchen gezielt Nachwuchs sichern möchten.
6.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Ausbildungsverbünde als Dienstleistungsanbieter verstehen. Ausbildungsverbünde sind in erster Linie als Anbieter spezifischer Leistungen zu betrachten, die für Betriebe einen klaren ökonomischen oder qualitativen Mehrwert erzeugen – etwa in den Bereichen Rekrutierung, grundlagenorientierte Erstqualifizierung in Ausbildungszentren, begleitendes Coaching oder Matching von Lernenden und Betrieben.
Qualitätsanforderungen an Einzelbetriebe präzisieren und durchsetzen. Stark spezialisierte Betriebe sollten entweder über Verbundstrukturen bzw. Ergänzungsausbildungen eine vollständige Ausbildung sicherstellen oder – sofern zumutbar – höheren formalen Anforderungen genügen. Dadurch erhöht sich der Anreiz zur Kooperation, ohne dass reguläre Lehrbetriebe benachteiligt werden.
Öffentliche Förderung strategisch ausrichten. Subventionen sind insbesondere dort sinnvoll, wo primär gesellschaftliche Zielsetzungen verfolgt werden, etwa die Förderung benachteiligter Jugendlicher, der Aufbau branchenspezifischer Ausbildungskapazitäten oder die Sicherstellung regionaler Ausbildungsangebote. Fördermittel sollten an überprüfbare Leistungsindikatoren wie Abschlussquoten, Stabilität der Lehrverhältnisse oder Übergänge in Erwerbstätigkeit gebunden sein.
Rolle der Branchenorganisationen stärken. Branchenverbände können durch die Bündelung von Nachfrage, die Setzung von Qualitätsstandards und die Förderung innovationsorientierter Praxis (z.B. neue Lerntechnologien, diagnostikgestützte Rekrutierung) zur Etablierung tragfähiger Verbundmodelle beitragen.
Rotation differenziert einsetzen. Regelmässige Betriebswechsel sind kein universell sinnvolles Prinzip. Sie sollten dort umgesetzt werden, wo sie betriebswirtschaftlich und ausbildungssystematisch vorteilhaft sind (z.B. Landwirtschaft, geförderte Modelle). In anderen Kontexten kann eine breitere Qualifizierung zweckmässiger über Ausbildungszentren oder Ergänzungsausbildungen erreicht werden.
Der vorliegende Text ist eine Synthese aus: Maurer, M., Zanola, L., & Hauser, K. (2024). Ausbildungsverbünde: Zusammenarbeit im Kontext von Lehrstellen- und Fachkräftemangel. Bern: hep.
Literatur
- BMBF (2024). Berufsbildungsbericht 2024. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Bundesrat (2003). Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) vom 19. November 2003 (Stand am 1. April 2022) (Vol. SR 412.101). Bern: Bundeskanzlei.
- Bundesversammlung (2002). Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002. Bern: Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
- Dornmayr, H. (2023). Lehrlingsausbildung im Überblick 2023: Strukturdaten, Trends und Perspektiven. Wien: ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft.
- Ebbinghaus, M., & Dionisius, R. (2020). Betriebliche Ausbildungskooperationen: Analysen zu Kooperationsbereichen und -mustern auf Grundlage des Referenz-Betriebs-Systems (RBS). Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis(4), 16–20.
- Gertsch, M. (1999). Der Lehrstellenbeschluss 1 – Evaluation: Ausbildungsverbünde. Bern: BBT / Koordinationsstelle für Weiterbildung der Universität Bern.
- Lachmayr, N. (2009). Chancen und Barrieren von Ausbildungsverbünden: Die Sicht österreichischer Unternehmen. BWP(3), 52–55.
- Leemann, R. J. (2019). Educational Governance von Ausbildungsverbünden in der Berufsbildung – die Macht der Konventionen. In Langer, R. / Brüsemeister, T. (Hrsg.), Handbuch Educational Governance Theorien (S. 265–287). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Maurer, M., Zanola, L., & Hauser, K. (2024). Ausbildungsverbünde: Zusammenarbeit im Kontext von Lehrstellen- und Fachkräftemangel. Bern: hep.
- SKBF (2023). Bildungsbericht Schweiz 2023. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
Zitiervorschlag
Maurer, M. (2025). Ausbildungsverbünde als Dienstleistungsanbieter. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (13).