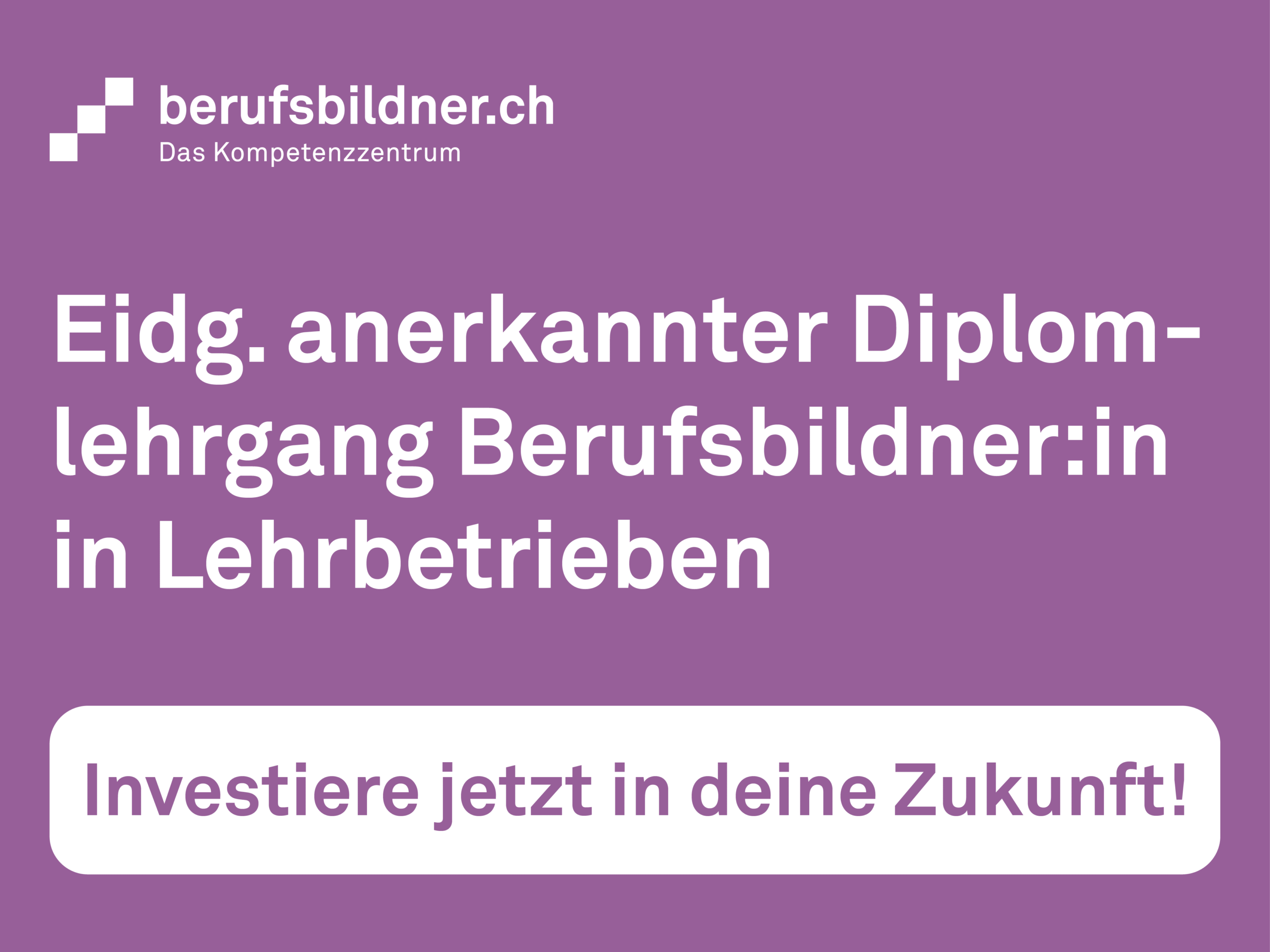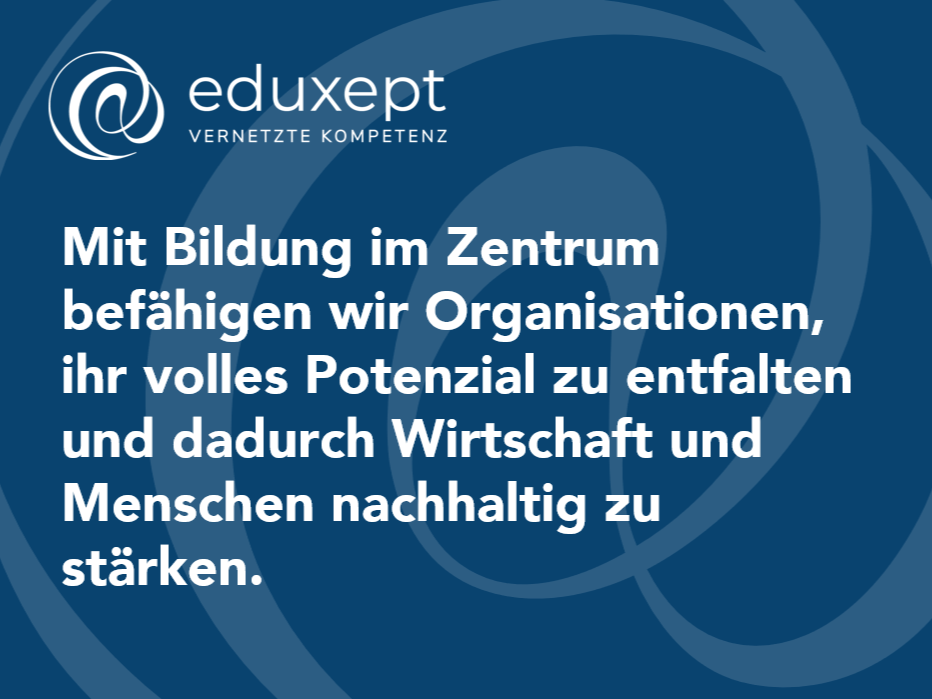Befragung der Lernenden in der Schweiz, Teil 1: Übersicht der zentralen Resultate
Psychische Gesundheit in der Berufslehre
Wie gut geht es den Jugendlichen in der Lehre? Diese Frage ist Gegenstand einer Studie von WorkMed, die im Juni dieses Jahres publiziert wurde. Zwei Faktoren machen die Studie besonders ergiebig: Die grosse Zahl der Jugendlichen, die befragt wurden und im Rahmen von Fokusgesprächen diskutierten, und die Breite und Tiefe der Fragestellungen: Das Ausfüllen der Fragebogen erforderte eine gute halbe Stunde. Die Autoren der Studie fassen die wichtigsten Ergebnisse in vier Beiträgen zusammen, die Transfer in den folgenden Wochen publizieren wird. Der vorliegende, erste Text gibt einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse.
Eine abgeschlossene Berufslehre kann als stabilisierender Faktor wirken – sie kann stärken, Halt geben, Perspektiven schaffen. Umgekehrt sind Lehrabbrüche sehr häufig bei jungen IV-Rentenbezügerinnen und -bezügern.
Die Berufslehre ist eine tragende Säule des Schweizer Bildungssystems: Rund 60 Prozent aller Jugendlichen entscheiden sich für eine duale Ausbildung – so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Im Jahr 2023 bestanden rund 210’000 Lehrverhältnisse, 66’000 Lernende schlossen ihre Ausbildung erfolgreich ab (BFS, 2024). Die Lehre markiert für viele junge Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt – in einer Lebensphase, die ohnehin von tiefgreifenden Veränderungen geprägt ist: der Entwicklung von Autonomie, Identität und Selbstbild. Der Übergang von der Schule in die Lehre bringt neue Anforderungen mit sich – vom Arbeitsalltag im Team über Selbstverantwortung und -Organisation bis hin zu neuen sozialen Erwartungen (Silbereisen & Weichhold, 2012; Neuenschwander, 2012).
Ein Thema rückt dabei zunehmend ins Zentrum: die psychische Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In den letzten Jahren ist der Anteil psychisch bedingter IV-Berentungen (BFS, 2024) sowie der krankheitsbedingten Absenzen in dieser Altersgruppe deutlich gestiegen (BFS, 2025). Gleichzeitig kann eine abgeschlossene Berufslehre als stabilisierender Faktor wirken – sie kann stärken, Halt geben, Perspektiven schaffen (vgl. z.B. Mischler & Huber, 2022). Umgekehrt sind Lehrabbrüche sehr häufig bei jungen IV-Rentenbezügerinnen und -bezügern (BSV, 2015).
Die öffentliche Debatte bewegt sich dabei oft zwischen Extremen resp. Überspitzungen oder Pauschalisierungen. Einige Schlagzeilen aus jüngerer Zeit:
- «Noch nie haben so viele junge Frauen ihren Lehrvertrag aufgelöst»
- «Fitnessabo, bessere Löhne und mehr Ferien: So wollen Betriebe die Berufslehre retten»
- «Psychische Gesundheit Jugendlicher verschlechtert sich zunehmend»
- «Verwöhnt und verweichlicht – das Netz empört sich über die Generation Alpha»[1]
Oft fehlen dabei differenzierte und fundierte Daten.
Wer ist WorkMed?
WorkMed AG ist ein Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit, das sich in Praxis und Forschung mit Arbeit und psychischer Gesundheit beschäftigt; es ist ein Joint Venture der Psychiatrie BL und der SWICA Krankenversicherung. WorkMed unterstützt unter anderem Berufsbildende und Lehrbetriebe sowie Berufsfachschullehrpersonen und Berufsfachschulen sowie Lernende in der Deutschschweiz mit Fallbesprechungen, Workshops, Kurzberatungen und Coachings. Weitere Informationen finden Sie hier. Kontakt: +41 61 685 15 15, kontakt@workmed.ch
Hier setzt die neue WorkMed-Studie[2] an. Aufbauend auf einer früheren Erhebung unter mehreren tausend Berufsbildenden zu ihren Erfahrungen mit psychisch belasteten Lernenden (Schmocker et al., 2022) wurde im Winter 2024/25 eine schweizweite Befragung aus der Perspektive der Lernenden selbst durchgeführt. Die Antworten von rund 45’000 Jugendlichen aus allen Sprachregionen waren auswertbar – eine bisher hinsichtlich Teilnahme und Vertiefung einzigartige Datengrundlage. Erfasst wurde, wie Lernende ihre Ausbildung erleben, was sie motiviert und stärkt – aber auch, was sie belastet. Zudem wurde erhoben, wie sie ihre psychische Gesundheit einschätzen und welche familiären, sozialen oder schulischen Faktoren damit zusammenhängen.
Die Ergebnisse zeigen ein vielschichtiges Bild: Viele Lernende erleben ihre Lehre als sinnstiftend, motivierend und entwicklungsfördernd. Gleichzeitig berichten sie von Herausforderungen und psychischen Belastungen.
Die Frage lautet also nicht: Krise oder keine Krise? Sondern vielmehr: Was brauchen Lernende, um erfolgreich durch die Lehre zu kommen? Was hilft – und was hindert? Und was können Berufsbildende, Schulen und Betriebe daraus lernen?
Ausgewählte Studienresultate – eine erste Übersicht
Im vorliegenden Beitrag fassen wir die wichtigsten Ergebnisse der Studie überblicksartig zusammen. In drei nachfolgenden Beiträgen in Transfer vertiefen wir Teilaspekte.
Ein gelungener Lehrstart mit Begleitung, Willkommensanlässen oder Einführungsprogrammen kann viel auffangen – wird aber gerade in kleineren Betrieben oft nicht systematisch umgesetzt.
Viel Vorfreude – und ebenso viele Sorgen. Die Lehre beginnt für viele Lernende mit einem Spannungsfeld: Einerseits freuen sich rund 80% auf ihren Einstieg ins Berufsleben – besonders auf das eigene Einkommen, mehr Selbstständigkeit und sinnstiftende sowie praktische Tätigkeiten. Andererseits berichten ebenso viele über Sorgen: etwa vor Überforderung bei schulischen Aufgaben (63%), Rahmendbedingungen wie Arbeitszeiten oder weniger Ferien (63%), fehlendes Verständnis für Fehler oder persönliche Schwierigkeiten (60%). Die Studie zeigt auch: Ein gelungener Lehrstart mit Begleitung, Willkommensanlässen oder Einführungsprogrammen kann viel auffangen – wird aber gerade in kleineren Betrieben oft nicht systematisch umgesetzt.
Die Lehre wird von der grossen Mehrheit positiv erlebt. Rund 80-90% der Lernenden geht es in der Lehre eher gut bis sehr gut, jeweils rund 85% finden es eher bis sehr spannend in der Lehre und sind stolz, in ihrem Lehrbetrieb zu arbeiten. Fast 90% haben das Gefühl, dass sie bei der Arbeit etwas Sinnvolles tun. 80-90% der Lernenden finden, dass ihre Berufsbildenden und Klassenlehrpersonen sie ernst nehmen, klare Erwartungen äussern, sich Zeit für sie nehmen, vertrauenswürdig sind und sich für sie engagieren.
Persönliches Wachstum. Die Lernenden wurden auch gefragt, ob und in welcher Hinsicht sie sich seit Lehrbeginn verändert hätten. Im Schnitt geben die Lernenden 12 von 15 möglichen persönlichen Fortschritten an. Die grosse Mehrheit der Lernenden erlebt seit Lehrbeginn ein deutliches und auch vielfältiges persönliches Wachstum: Nicht nur in den Kompetenzen, sondern auch im Selbstvertrauen, in der Sozialkompetenz, in der Selbstreflexion, hinsichtlich Fleiss, Ehrgeiz, Motivation, Durchhaltevermögen, Neugier, Interesse und Berufsstolz.
Psychische Belastungen. Auf die offene Frage «Hattest du während der Lehre psychische Probleme, z.B. negative Gefühle oder Gedanken, Belastungen oder auch psychische Krankheiten oder Krisen?» geben insgesamt 61% der Lernenden an, dass sie während der Lehre schon einmal (rund ein Viertel) oder schon mehrmals (rund ein Drittel) psychische Probleme hatten. Wichtig ist hier festzuhalten, dass 42% der Lernenden angeben, dass sie schon vor der Berufslehre psychische Belastungen hatten.
Viele Lernende erleben gleichzeitig Verschiedenes wie Belastungen und Entwicklung, Stolz und Stress, Ängste und Freude. Diese Gleichzeitigkeit zeigt auf, dass es ein erweitertes Verständnis von psychischer Gesundheit braucht.
Diese scheinbare Widersprüchlichkeit ist zentral: Viele Lernende erleben gleichzeitig Verschiedenes wie Belastungen und Entwicklung, Stolz und Stress, Ängste und Freude. Diese Gleichzeitigkeit zeigt auf, dass es ein erweitertes Verständnis von psychischer Gesundheit braucht. Wir müssen psychische Gesundheit als Balance zwischen Belastung und Bewältigung verstehen. Eine gute psychische Gesundheit ist weit mehr als die Absenz von psychischen Erkrankungen, sie ist eben beispielsweise auch das Erleben von Sinn, Kompetenz oder Selbstwirksamkeit. Die Lehre kann auch für teils schon früh belastete Jugendliche ein Ort der Stärkung sein – wenn Rahmen und Beziehungen stimmen.
Umgang mit psychischen Belastungen. Grundsätzlich fühlen sich 80% und mehr der Lernenden von den Berufsbildenden ernst genommen und fachlich gut unterstützt (vgl. weiter oben). Etwas seltener (in rund 75% der Fälle) erleben die Lernenden, dass Berufsbildende sich für sie interessieren und sie unterstützen, wenn es ihnen nicht gut geht. Die Aussage, dass «Probleme offen angesprochen werden» erhielt die tiefste Zustimmung: Im Lehrbetrieb wird dies von 74% der Lernenden bejaht, in der Berufsfachschule von rund 60%. Während demnach viele wichtige Aspekte von Klima und Beziehung sehr positiv erlebt werden, ist dies immer dann etwas weniger der Fall, wenn es um das Befinden der Lernenden geht oder um das Ansprechen und Unterstützen bei Problemen.
Bei persönlichen Themen der Lernenden verhalten sich die Berufsbildenden also zurückhaltender. Dies kann mit den Unsicherheiten der Berufsbildenden im Zusammenhang stehen. In der Befragung der Berufsbildenden (Schmocker et al. 2022) geben Berufsbildende unabhängig von ihrer Erfahrung in der Funktion an, dass sie sich in der Begleitung von Lernenden am unsichersten fühlen, wenn es um «psychische» Themen geht. Gleichzeitig wenden sich Lernende selten an ihre Berufsbildenden, wenn es ihnen nicht gut geht oder sie erwägen, die Lehre abzubrechen. D.h. von beiden Seiten besteht eine Zurückhaltung, wenn es um persönliche resp. psychische Themen geht.
Die meisten Lernenden finden bei psychischen Problemen Unterstützung im Freundeskreis und in der Familie. Bei 78% fand wegen der psychischen Probleme in der Lehre weder ein Gespräch im Lehrbetrieb noch in der Berufsfachschule statt. 68% der Lernenden teilen ihre Probleme den Verantwortlichen in der Lehre nicht mit. Die Gründe, warum sie dies nicht tun: 36% wollen es «alleine schaffen», 26% der Lernenden wissen nicht, wie man über «solche Dinge» spricht oder ob es schon «schlimm genug» sei.
Lehrabbrüche – Gedanken, Erfahrungen, Gründe. Die Hälfte der Lernenden denkt während der Ausbildung mindestens einmal darüber nach, die Lehre abzubrechen. Ein Viertel der Lernenden hat mehrfach über einen Abbruch nachgedacht. 22% denken aktuell darüber nach. Etwa 9% haben bereits früher eine Lehre abgebrochen. Die häufigsten Gründe: mangelnde Passung zum Beruf, psychische Probleme (v.a. bei jungen Frauen) und Konflikte im Betrieb – oft mit Berufsbildenden. Besonders negativ wirkt sich aus, wenn Lernende das Gefühl haben, nicht gut genug oder nicht willkommen zu sein. Ermutigend ist aber: Viele Lernende brechen trotz Problemen nicht ab – weil sie nicht aufgeben wollen, Vertrauen spüren oder ihre Eltern ihnen nahelegen, dranzubleiben. Das zeigt: Abbruchgedanken sind weit verbreitet, aber kein Zeichen mangelnder Belastbarkeit.
Selbstwirksamkeit – ein starker Schutzfaktor. Die Überzeugung, Herausforderungen bewältigen zu können, ist einer der stärksten Schutzfaktoren für psychische Gesundheit. Rund 90% der Lernenden sind zuversichtlich, ihre Lehre erfolgreich abzuschliessen und etwa zwei Drittel zeigen eine mittlere bis hohe Selbstwirksamkeit. Die Studie zeigt, dass sich diese Fähigkeit im Verlauf der Lehre weiterentwickelt. Wichtig: Selbstwirksamkeit entsteht nicht allein aus individueller Stärke, sondern auch durch eine gute Atmosphäre und gute Beziehungen in der Lehre, passende Anforderungen, konstruktives Feedback, Mitgestaltungsmöglichkeiten und das Vertrauen, etwas bewirken zu können – im Team, bei Berufsbildenden, in der Schule.
Schlussfolgerung
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Berufslehre für viele Jugendliche weit mehr ist als ein Einstieg in die Arbeitswelt – sie ist ein zentraler Entwicklungsraum, fachlich, persönlich, sozial.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Berufslehre für viele Jugendliche weit mehr ist als ein Einstieg in die Arbeitswelt – sie ist ein zentraler Entwicklungsraum, fachlich, persönlich, sozial. Gleichzeitig erleben zahlreiche Lernende zwischenmenschliche Belastungen, fachliche Überforderung und persönliche Krisen. Diese Ambivalenz – zwischen Belastungen und Entwicklung, Stolz und Stress oder Ängsten und Freude – gehört zur Realität der jungen Menschen. Entscheidend ist, wie Betriebe, Berufsbildende, Schulen, Lehrpersonen und die Lernenden selber damit umgehen. Wertschätzende Beziehungen, ein begleiteter Einstieg, realistische Anforderungen und eine offene Gesprächskultur sind Schlüsselfaktoren, um die Lehre als stabilisierende Lebensphase zu gestalten. Gerade die berufliche Grundbildung ist mit ihrem praxisnahen, konkreten und beziehungsmässigem Setting eine besondere Chance für persönliches Wachstum der Lernenden.
Vier Impulse für die Praxis
- Psychische Probleme gehören auch zu einem gesunden Leben und zum Alltag – aber sie sollten angesprochen werden.
- Selbstwirksamkeit kann man durch gute Arbeitsatmosphäre, gute Beziehungen und gute Ausbildungsbedingungen fördern – nicht nur «Resilienz fordern».
- Beziehung vor Struktur: Berufsbildende und Lehrpersonen sind Schlüsselpersonen; wenn sie echtes Interesse an den Lernenden zeigen, können sie den Unterschied machen.
- Die Lehre als Chance ernst nehmen. Sie ist es auch für belastete Jugendliche mit schwierigen Schulerfahrungen.
In den nächsten Beiträgen der Reihe nehmen wir einzelne Aspekte vertieft unter die Lupe: Was brauchen Lernende mit psychischen Problemen konkret? Welche Typen von Lernenden gibt es? Welche Rolle spielen Berufsbildende – und wie erleben sie ihre Verantwortung? Und: Was bedeutet das alles für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Berufsbildung?
Interview mit Barbara Schmocker: Fleischmann, D. (2025). Viele Jugendliche sind belastet, aber die meisten fühlen sich in der Lehre trotzdem wohl. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10(9) (Erstpublikation in Alpha, Tages-Anzeiger).
Merkmale der Befragung und der teilnehmenden Personen
Bereits in der Vorbereitungsphase ab 2023 wurden alle relevanten Stakeholder aus der Berufsbildung in der Schweiz persönlich kontaktiert. Das Vorhaben wurde den verantwortlichen Organisationen vorgestellt, wodurch nicht nur die inhaltliche Ausrichtung erläutert, sondern auch eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden konnte. Einbezogen wurden insbesondere die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK), die Tripartite Berufsbildungskonferenz (TBBK) sowie die Schweizerische Direktorinnen- und Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen (SDK) und die Table Ronde Berufsbildender Schulen (TR BS). Der Vorstand der SBBK unterstützte das Projekt ideell und empfahl den Mitgliedern die Teilnahme an der Befragung. Diese breite Abstützung war ein zentraler Erfolgsfaktor für die Rekrutierung einer grossen Anzahl an Teilnehmenden.
Die Datenerhebung erfolgte mittels einer standardisierten Online-Befragung, die vom 28. Oktober bis 13. Dezember 2024 durchgeführt wurde. Zielgruppe waren alle Lernenden in der dualen Berufsbildung (EBA, EFZ, EFZ mit Berufsmaturität) sowie zusätzlich Schülerinnen und Schüler aus vollschulischen Ausbildungen (Informatikmittelschule, Handelsmittelschule, Fachmittelschule) in der gesamten Schweiz (deutsch-, französisch- und italienischsprachige Regionen). Die hier vorgestellten Resultate betreffen die duale Berufsbildung, da die Teilnahme der vollschulischen Ausbildungen stark unterrepräsentiert war. Die Teilnahme war freiwillig; die Berufsfachschulen sowie die Lehrpersonen entschieden selbst, ob sie ihre Lernenden zur Teilnahme anregen. Den Lernenden wurde für die Teilnahme eine Schullektion zur Verfügung gestellt.
Zur Qualitätssicherung wurde eine Begleitgruppe mit Vertretungen zentraler Institutionen aus Bildung, Berufsbildung und Gesundheitsförderung eingerichtet. Diese Gruppe war über alle Projektphasen hinweg aktiv und für die Teilnahme und Verankerung der Studie im Feld entscheidend.
Die Befragung erfasste umfassend, wie es den Lernenden in der Lehre geht, wie sie diese wahrnehmen und welchen Einfluss die Ausbildung auf ihr Wohlbefinden und ihre psychische Gesundheit hat. Dabei wurden auch familiäre und soziale Hintergründe sowie retrospektive Erfahrungen aus Schulzeiten berücksichtigt. Validierte Screening-Fragen zur psychischen Situation, die auch in der Schweizerischen Gesundheitsbefragung oder vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Peter et al., 2023)) verwendet werden, ermöglichten zudem Vergleiche mit der allgemeinen jungen Bevölkerung.
Die Einbindung der Lernenden war ein zentrales Anliegen. Um sicherzustellen, dass die Befragung alle für sie relevanten Themen abdeckt, wurden von Januar bis Juni 2024 parallel zur Entwicklung des Fragebogens Fokusgruppen mit Lernenden sowie mit Ausbildungsverantwortlichen (wie Lehrpersonen und Ausbildungsleitende) durchgeführt. Nach Abschluss der Erhebung wurden die Ergebnisse gemeinsam mit den Lernenden diskutiert.
Literatur
- Baer, N., Schmocker, B., & Kuhn, T. (2022). Wie soll man mit psychisch belasteten Lernenden umgehen?. Berufsbildung in Forschung und Praxis 7(1).
- Bundesamt für Statistik (2023). Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus. Resultate zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ), Neuchâtel. Bundesamt für Statistik.
- Bundesamt für Statistik (2024). IV-Statistik. Bern.
- Bundesamt für Statistik (2024), Absenzen, Bern
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2025). Absenzen in der Erwerbsbevölkerung – 2024.
- Baer, N. ea. (2015). Profile von jungen IV-Neurentenbeziehenden mit psychischen Krankheiten. Beiträge zur sozialen Sicherheit, Nr. 19/15.
- Mischler, M. & Huber, S.G. (2022). Bildungswege und psychische Gesundheit. In S.G. Huber (Hrsg.), Young Adult Survey Switzerland, Band 3 (S. 81–96). Bern: BBL / OFCL / UFCL.
- Silbereisen, R. K. & Weichold, K. (2012). Jugend (12 – 19 Jahre). In W. Schneider, W. Lindenberger (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (7. überarb. Aufl., S. 235-258). Weinheim: Beltz.
- Neuenschwander, M. P. (2012). Schule und Beruf: Wege in die Erwerbstätigkeit (1. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Peter, C., Tuch, A. & Schuler, D. (2023). Psychische Gesundheit – Erhebung Herbst 2022. Wie geht es der Bevölkerung in der Schweiz? Sucht sie sich bei psychischen Problemen Hilfe? (Obsan Bericht 03/2023). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Schmocker, B., Kuhn, T., Frick, U., Schweighauser, C., Baumgartner, R. Diesch, R., Ettlin, P., Frei, A., & Baer, N. (2022). Umgang mit psychisch belasteten Lernenden – Eine Befragung von Berufsbildner*innen in der Deutschschweiz. Binningen: WorkMed.
Zitiervorschlag
Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Psychische Gesundheit in der Berufslehre. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (11).