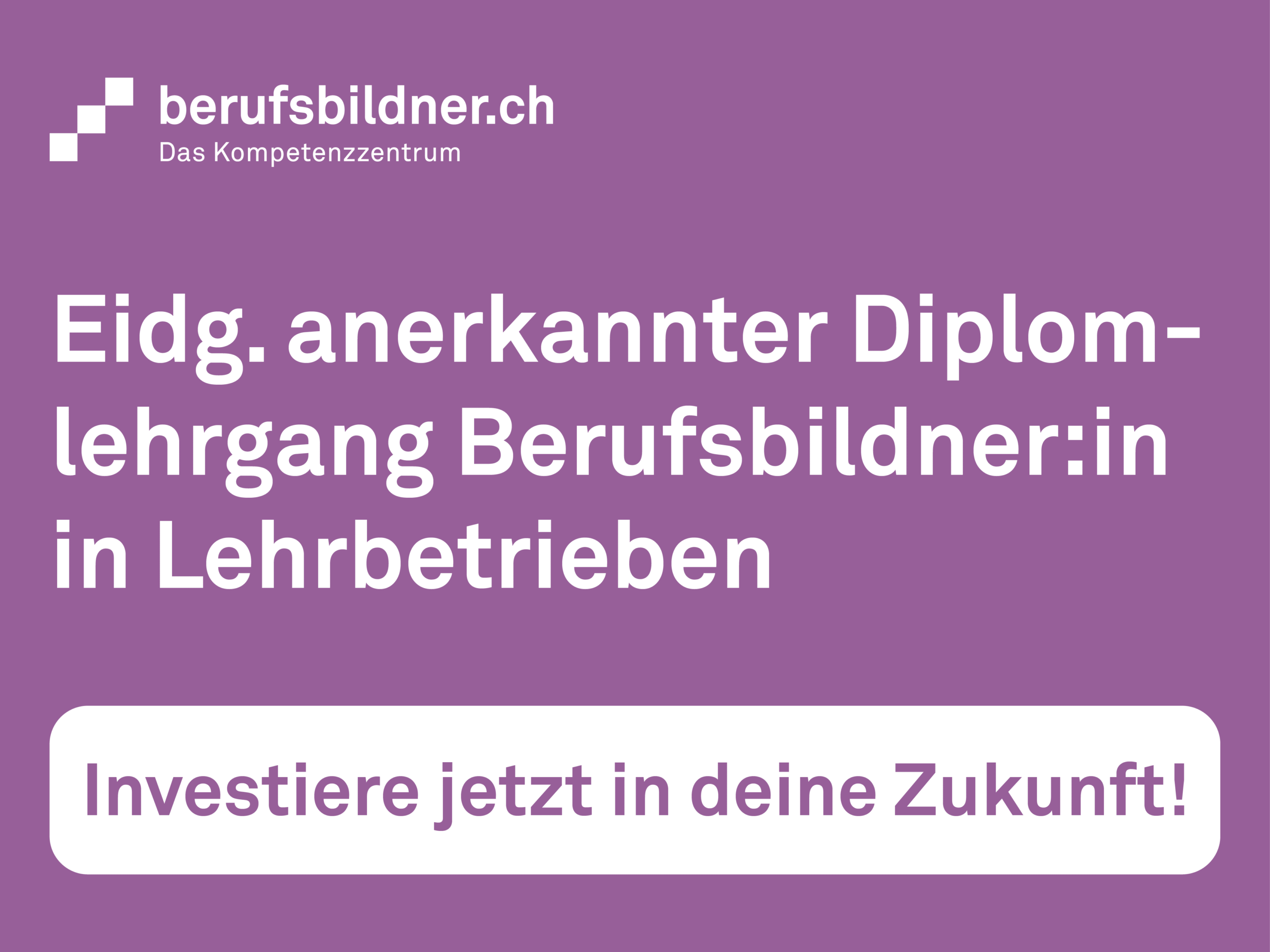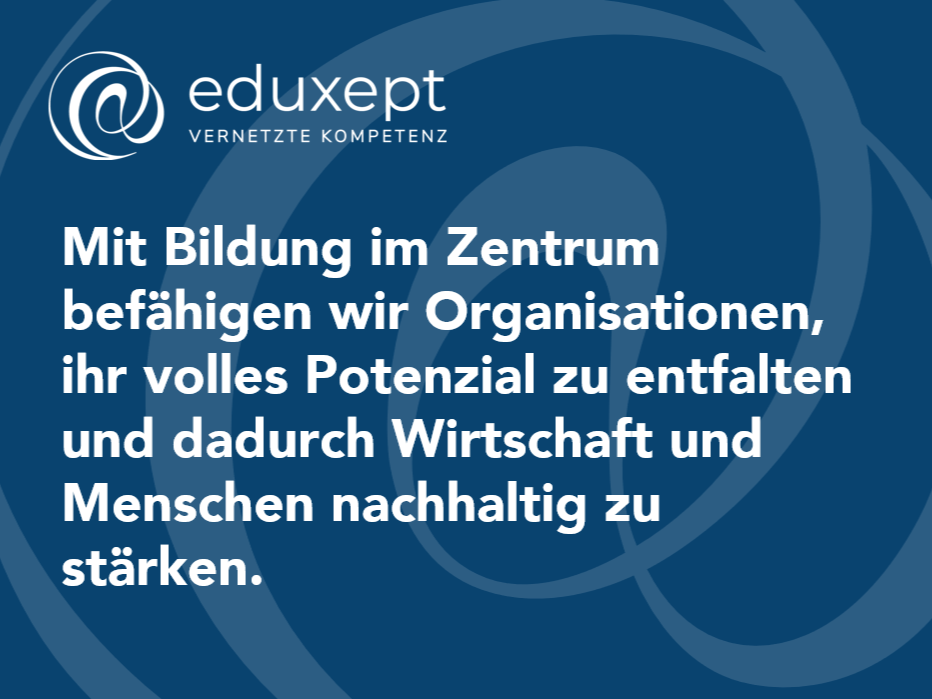Befragung der Lernenden in der Schweiz, Teil 3: Psychische Gesundheit in der Lehre
Wie Jugendliche in der Lehre ihren psychischen Belastungen trotzen
Wie erleben die Jugendlichen den Schritt in die berufliche Grundbildung? Dies ist die zentrale Frage der Studie «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre». Ihre Autoren fassen die wichtigsten Ergebnisse in vier Transfer-Beiträgen zusammen. Der vorliegende, dritte Text vertieft die Frage, wie es den Jugendlichen psychisch geht. Er zeigt, dass rund 60% der Lernenden während der Lehre mindestens schon einmal psychische Probleme hatten. Aber so alarmierend der Befund klingt, so erleben die meisten Jugendlichen die Lehre doch als Ort, wo sie mit Belastungen erfolgreich umzugehen lernen.
Auf die Frage «Hattest du schon mal in der Schule psychische Probleme oder Belastungen?» berichten rund 42% der Lernenden, bereits vor Lehrbeginn psychische Schwierigkeiten gehabt zu haben.
Die Berufslehre ist für die meisten Jugendlichen ein zentraler Übergang in die Erwachsenenwelt. Sie dient nicht nur der Aneignung fachlicher Kompetenzen, sondern stellt auch eine Phase dar, in der Identität, Selbstwert und Selbstwirksamkeit besonders stark auf dem Prüfstand stehen. Ob Jugendliche diese Phase als bereichernd oder belastend erleben, hängt nicht allein von den Anforderungen in Schule und Betrieb ab, sondern auch davon, wie es um ihre psychische Gesundheit steht. So kann die Lehre als ein Ort gesehen werden, an dem sich die psychische Gesundheit von Lernenden festigen, aber auch ins Wanken geraten kann.
Psychische Belastungen schon vor der Lehre
Die Vorstellung, Jugendliche würden unbelastet in die Lehre eintreten und erst im Verlauf mit Problemen konfrontiert, ist unvollständig. Auf die Frage «Hattest du schon mal in der Schule psychische Probleme oder Belastungen?» berichten rund 42% der Lernenden, bereits vor Lehrbeginn psychische Schwierigkeiten gehabt zu haben. Dabei handelt es sich nicht ausschliesslich um klinisch diagnostizierte Störungen, sondern um ein breites Spektrum an Belastungen: Ängste, depressive Verstimmungen, schulische Überforderung, familiäre Konflikte.[1]
Epidemiologische Studien stützen dieses Bild: Die Hälfte aller psychischen Störungen beginnt vor dem 15. Lebensjahr (Kessler et al., 2005). Wer also schon früh mit Belastungen zu kämpfen hatte, bringt sie häufig auch in die Lehre mit. Prävention darf daher nicht erst in der Lehre ansetzen. Entscheidend ist, psychische Schwierigkeiten bereits in der Kindheit und Jugend wahrzunehmen, Jugendliche im Umgang mit diesen Herausforderungen zu stärken und ihnen passende Unterstützung zugänglich zu machen. Was sich in dieser Phase als hilfreich erweist, kann auch beim Übergang in die Lehre weitergeführt und genutzt werden. Eltern, Schulen und Berufsberatung übernehmen dabei eine Schlüsselrolle, sowohl beim frühzeitigen Erkennen als auch beim Begleiten des Übergangs.
Belastungen während der Lehre – Symptome, Ursachen und Folgen
Psychische Probleme sind aber auch während der beruflichen Grundbildung keine Ausnahme. Die Lernenden wurden gefragt, ob sie während der Lehre psychische Probleme, negative Gefühle oder Gedanken, Belastungen oder sogar psychische Krankheiten oder Krisen erlebt hätten. Mehr als 60% gaben an, während der Lehrzeit mindestens einmal psychisch belastet gewesen zu sein, ein Drittel sogar mehrfach. Besonders häufig genannt werden depressive Symptome, Ängste oder anhaltende Selbstzweifel.
Die Ursachen sind vielfältig. Über die Hälfte der Lernenden benennt Faktoren im Lehrbetrieb oder in der Berufsfachschule (Leistungsdruck, Konflikte im Betrieb, das Gefühl, Anforderungen nicht zu genügen). Daneben spielen auch familiäre Belastungen (49%) oder Probleme im Freundeskreis (31%) eine Rolle. Rund ein Drittel kann keinen klaren Auslöser nennen.
Rund ein Viertel der Jugendlichen gibt an, dass sich ihre psychischen Probleme direkt auf die Leistung in der Lehre ausgewirkt haben. Absenzen, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedanken an einen Lehrabbruch sind typische Folgen.
Besonders problematisch wird es, wenn mehrere Belastungsfelder zusammenkommen: Jugendliche, die sowohl im Betrieb wie auch im privaten Umfeld Schwierigkeiten haben, zeigen die höchsten Belastungswerte. Rund ein Viertel der Jugendlichen gibt an, dass sich ihre psychischen Probleme direkt auf die Leistung in der Lehre ausgewirkt haben. Absenzen, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedanken an einen Lehrabbruch sind typische Folgen. Gleichzeitig zeigt sich: Auch stark belastete Jugendliche halten oft an der Lehre fest. Viele wollen «nicht aufgeben» – ein Hinweis auf bemerkenswerte Resilienz.
Umgang mit psychischen Problemen
Die meisten Lernenden suchen bei psychischen Herausforderungen in erster Linie im privaten Bereich Hilfe. Von den rund 60% Lernenden, welche in der Befragung angaben, dass sie während der Lehre mindestens schon einmal psychische Probleme hatten, wird besonders die Unterstützung von Freunden (55%) und Familie (45%) als hilfreich erlebt. Rund ein Drittel der Lernenden war wegen psychischer Probleme in einer ärztlichen Behandlung oder Beratung. Dabei zeigt sich ein linearer Zusammenhang: Je schwerwiegender die Probleme wahrgenommen werden, desto häufiger wird professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Dabei wirkt sich die Behandlung subjektiv positiv auf das Wohlbefinden aus, doch im Kontext der Ausbildung zeigt sich dieser Effekt lediglich bei einem Drittel der Lernenden.
Berufsbildende und Lehrpersonen werden von der grossen Mehrheit der Lernenden als engagiert und unterstützend erlebt. Fachliche Förderung, ernst genommen werden, ein respektvoller Umgang – all das trägt entscheidend zum Wohlbefinden bei. Trotzdem wird im Ausbildungsumfeld kaum über psychische Belastungen gesprochen: Bei 78% fand wegen der Probleme weder ein Gespräch im Lehrbetrieb noch in der Berufsfachschule statt. Gespräche mit der Lehraufsicht kamen in nur 8% der Fälle vor. Dieses Muster zeigt sich über die Sprachregionen hinweg sehr ähnlich. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wobei Mehrantworten möglich waren: 36% wollen es «alleine schaffen», 26% der Lernenden wissen nicht, wie man über «solche Dinge» spricht oder ob es schon «schlimm genug» ist, 23% glauben, man würde sie nicht verstehen und je rund 20% vertrauen den Verantwortlichen nicht, schämen sich oder wollen niemanden mit ihren Problemen belasten.
Entscheidend ist, Hemmschwellen abzubauen und zu zeigen: Psychische Probleme sind kein Tabu. Der geringe Anteil von nur 1,5 bis 2% der Lernenden, die bestehende Beratungsstellen nutzen, verdeutlicht, dass die vorhandenen Angebote kaum greifen.
Es zeigt sich, dass Lernende auf psychische Belastungen häufig mit Rückzug reagieren – etwa durch Absenzen, Gedanken an einen Lehrabbruch oder indem sie im Ausbildungskontext schweigen. Psychische Probleme bleiben dadurch oft aus Scham oder Unsicherheit unsichtbar. Für Betriebe und Schulen ergibt sich daraus die Herausforderung, Räume für Gespräche zu schaffen und Ansprechpersonen zu benennen, die niederschwellig und vertrauensvoll unterstützen können – unabhängig vom Schweregrad. Entscheidend ist, Hemmschwellen abzubauen und zu zeigen: Psychische Probleme sind kein Tabu. Der geringe Anteil von nur 1,5 bis 2% der Lernenden, die bestehende Beratungsstellen nutzen, verdeutlicht zudem, dass die vorhandenen Angebote kaum greifen. Damit Lernende ein Unterstützungsangebot annehmen, soll es vor allem kostenlos und anonym sein.
Psychische Gesundheit ist nie nur eine individuelle Frage, sondern auch eine Beziehungsfrage. Auch familiäre Unterstützung bleibt während der Lehre zentral – auch wenn Jugendliche zunehmend Autonomie anstreben. Fehlt diese Unterstützung, erhöht sich das Risiko für Schwierigkeiten im Lehrverlauf deutlich (Schmocker et al., 2022).
Selbstwert, Selbstwirksamkeit und Umgang mit Frust
Lernende reagieren auf Frustration und Defizite unterschiedlich. Viele versuchen, ihre Reaktionen zu kontrollieren (62%) oder planen Schritte, um ihre Situation zu verbessern. Gleichzeitig treten Selbstvorwürfe, Zweifel oder Scham auf, besonders bei weiblichen Lernenden (70%). Im Umgang mit Defiziten suchen die meisten aktiv nach Lösungen, etwa indem sie Unterstützung bei Berufsbildnerinnen oder Kollegen suchen oder zuhause mehr lernen. Ein kleiner Teil (16%) erwägt einen Lehrabbruch.
Der Umgang mit Belastungen hängt stark vom Selbstwertgefühl und ihrem Vertrauen in die eigene Wirksamkeit ab. Lernende mit hohem Selbstwert und hoher Selbstwirksamkeit entwickeln häufiger konstruktive Strategien: Sie planen ihre nächsten Schritte, suchen Hilfe, behalten den Überblick und handeln lösungsorientiert. Wer dagegen einen niedrigen Selbstwert oder geringe Selbstwirksamkeit hat, reagiert eher mit Rückzug, Scham, Selbstzweifeln oder emotionalen bzw. vermeidenden Reaktionen. Rund ein Viertel der Lernenden weist eine geringe Selbstwirksamkeit auf und hat demnach wenig Vertrauen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können. Positiv ist: Über die Lehrjahre hinweg steigt das Erleben von Selbstwirksamkeit deutlich an. Viele Jugendliche wachsen trotz Schwierigkeiten an ihren Erfahrungen. Dieses «daran wachsen» ist ein wichtiger Schutzfaktor. Für die Praxis bedeutet das: Lehrbetriebe und Schulen sollten gezielt Erfolgserlebnisse ermöglichen. Lernende, die sich selbstwirksam erleben, gelingt es besser, ihr Potenzial während der Lehre gut zu entfalten. Schon kleine, sichtbare Fortschritte stärken Selbstwert und Selbstwirksamkeit und tragen damit wesentlich zur psychischen Gesundheit bei (Bandura, 1997).
Ressourcen, Stolz und positive Förderung
Bei aller Belastung dürfen die positiven Erfahrungen nicht übersehen werden. Ein Grossteil der Lernenden besitzt Berufsstolz (87%) und eine grosse Mehrheit berichtet von deutlichem Wachstum seit Lehrbeginn.
Bei aller Belastung dürfen die positiven Erfahrungen nicht übersehen werden. Ein Grossteil der Lernenden besitzt Berufsstolz (87%) und eine grosse Mehrheit berichtet von deutlichem Wachstum seit Lehrbeginn – fachlich wie persönlich. Mehr Selbstvertrauen, mehr Eigenverantwortung, mehr Motivation: Viele Jugendliche sind stolz auf das, was sie leisten.
Erfolgserlebnisse, konstruktives Feedback und das Zutrauen, Herausforderungen selbst zu meistern, sind zentrale Schutzfaktoren. Sie fördern psychische Stabilität und geben Kraft, auch schwierige Phasen zu überstehen. Positive Förderung bedeutet nicht, Belastungen kleinzureden. Vielmehr geht es darum, Lernende in ihrer Fähigkeit zu unterstützen, Lösungen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen – bei gleichzeitiger Begleitung.
Fazit und Handlungsimplikationen
Psychische Belastungen sind in der Lebensrealität von Lernenden weit verbreitet. Sie beginnen oft schon vor Lehrbeginn und setzen sich während der Lehre fort. Doch die Lehre ist nicht nur Risikofeld, sondern auch eine enorme Chance: Viele Jugendliche wachsen an ihren Erfahrungen, entwickeln Selbstvertrauen und Stolz.
Damit dies gelingt, braucht es die Unterstützung von Betrieben, Schulen und engen Bezugspersonen. Zentral sind:
- Prävention muss früh ansetzen: Psychische Belastungen früh erkennen, Bewältigungsstrategien fördern und diese Unterstützung beim Übergang in die Lehre fortführen.
- Offene Gesprächskultur: Psychische Probleme enttabuisieren.
- Rolle von Bezugspersonen: Eltern, Freundinnen und Freunde sind wichtig bei alltäglichen psychischen Belastungen, Fachpersonen bei schwerwiegenden Problemen zentral.
- Selbstwirksamkeit stärken: Erfolgserlebnisse und Vertrauen in die eigene Problemlösefähigkeit als zentrale Schutzfaktoren fördern.
Literaturhinweise
- Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W. H. Freeman & Company: New York.
- Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K.R., & Walters, E.E (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. Jun;62(6):593-602.
- Peter, C., Tuch, A. & Schuler, D. (2023). Psychische Gesundheit – Erhebung Herbst 2022. Wie geht es der Bevölkerung in der Schweiz? Sucht sie sich bei psychischen Problemen Hilfe? (Obsan Bericht 03/2023). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Schmocker, B., Kuhn, T., Frick, U., Schweighauser, C., Baumgartner, R. Diesch, R., Ettlin, P., Frei, A., & Baer, N. (2022). Umgang mit psychisch belasteten Lernenden – Eine Befragung von Berufsbildner*innen in der Deutschschweiz. Binningen: WorkMed.
Zitiervorschlag
Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Wie Jugendliche in der Lehre ihren psychischen Belastungen trotzen. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (13).