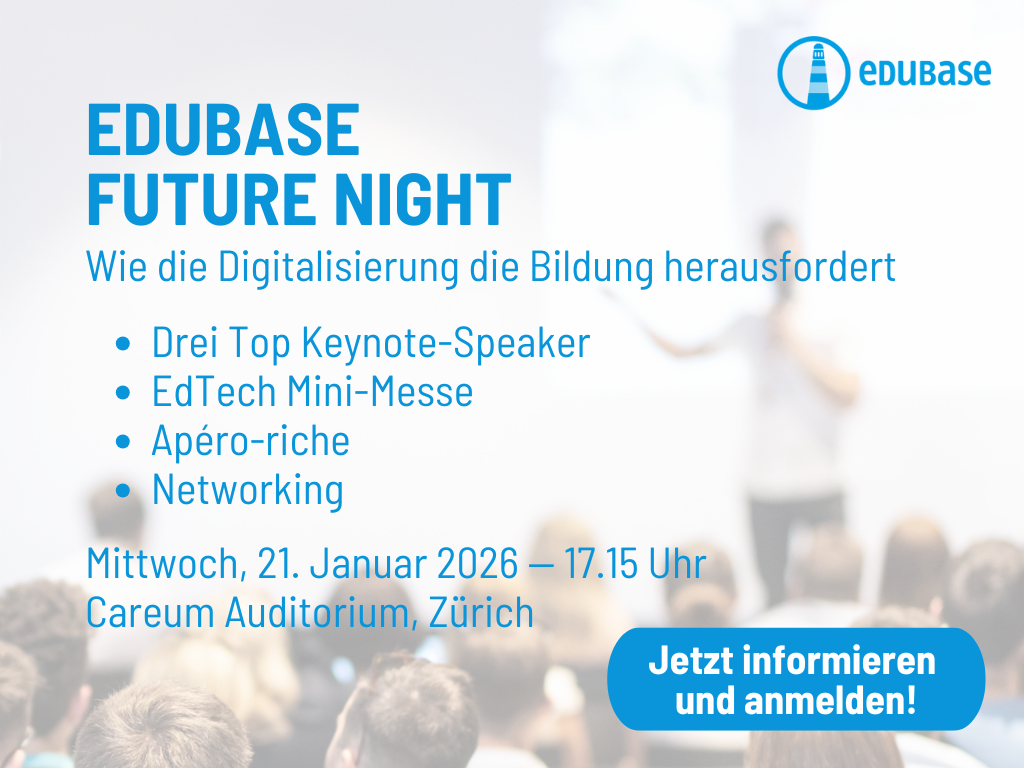«Berufsbildung 2040 – Perspektiven und Visionen»: Die Berufsbildung darf nicht zur zweiten Wahl werden!
Stark bleiben in einer sich wandelnden Welt
Die Berufsbildung sollte sich aktiver ihren Herausforderungen stellen. Lehrabbrüche, Imageprobleme und belastete Jugendliche sind drei Problemfelder, die mutigere Reaktionen erfordern. Zu diesen Reaktionen gehören ein besserer Umgang mit den Jugendlichen, die Einbindung von Fremdsprachen in alle beruflichen Grundbildungen, innovativere Lernsettings und Imagekampagnen. Dafür müssen sich alle Verbundpartner bewegen.
Als die Bilder digital wurden – Erinnerungen an eine Umbruchzeit
Liegt das daran, dass sich die Berufsbildung zu lange auf ihren Stärken und Erfolgen ausgeruht hat?
Meine Lehre machte ich zu Beginn der 90er-Jahre in einem grafischen Betrieb. Der Wandel zu digitaler Produktion und Bildbearbeitung hatte begonnen, und die ersten grossen Trommelscanner kamen auf den Markt. Mein Lehrmeister war ein Experte in der analogen Produktion, ein wahrer Künstler im Umgang mit Reproduktionskamera, Filmmaterial und Chemie zur Entwicklung und Fixierung der Bilder. Er war ein «Star» in unserem Unternehmen, denn er konnte durch Um- und Einkopieren Fotomontagen herstellen, die in der damaligen Zeit Ihresgleichen suchten. Als Crosfield Electronics einen Rechner auf den Markt brachte, der die digitale Bildbearbeitung ermöglichte, wurde mir schnell klar, dass wir in unserem Betrieb schon sehr bald kein Filmmaterial mehr benötigen würden. Mein Berufsbildner war von der neuen Technologie nicht überzeugt, da die Qualität der ersten Scans tatsächlich noch fehlerhaft und ungenügend war. Er versuchte zu beweisen, dass man die digitale Produktion mit noch besserer analoger Arbeit und hoher Perfektion aufhalten könne. Ein hoffnungsloser Versuch, wie wir heute wissen. Er weigerte sich, die digitale Technologie zu erlernen, und so wurde er einige Jahre später entlassen, da man ihn in der Produktion nicht mehr einsetzen konnte.
Was sich hier in meinem kleinen Umfeld ereignete, war schon oft im Kleinen und auch Grossen seit Jahrhunderten passiert. So hatten sich die Segelschiffbauer gegen die aufkommende Dampfschifffahrt gewehrt, indem sie zusätzliche Segel montierten, um eine höhere Geschwindigkeit als die Dampfschiffe zu erreichen. Ein Beispiel aus unserer Zeit: Der finnische Konzern Nokia verpasste als damaliger Marktleader den Einstieg in die Smartphone-Technologie, da er zu lange vom eigenen Weg überzeugt war und nicht an das glaubte, was sich bereits Jahre vor der Produktion des ersten iPhones abzeichnete.
Auch die Berufsbildung steht heute vor dieser Prüfung. Sie integriert junge Menschen, öffnet Perspektiven für Migrantinnen und Migranten und versorgt die Wirtschaft – ihre Stärke ist in der Schweiz unwidersprochen. Doch gleichzeitig verliert sie offensichtlich an Attraktivität, viele brechen die Lehre ab, 2025 sind rund 10’000 offene Lehrstellen unbesetzt, Jugendliche klagen über einen zu rauen Umgangston und psychische Belastungen. Liegt das daran, dass sich die Berufsbildung zu lange auf ihren Stärken und Erfolgen ausgeruht hat?
Problemfelder – woran die Berufsbildung heute krankt
Image und Attraktivität – besonders in Städten und in der Westschweiz
Die Berufsbildung gilt international vielerorts weiterhin als «zweite Wahl» (Cedefop 2024). In der Schweiz trifft das für städtische Gebiete, aber auch für Teile der Westschweiz in der Tendenz ebenfalls zu. Im Kanton Basel-Stadt wählen überdurchschnittlich viele Jugendliche das Gymnasium – im Vergleich zu ländlichen Kantonen, wo mehr Jugendliche die Lehre absolvieren. Das zeigt: In der Stadt ist das Image der Berufslehre schlechter, denn akademische Wege werden dort bevorzugt. Gerade hier braucht es eine gezielte Imagearbeit, um den dualen Weg als gleichwertig sichtbar zu machen.
Lehrabbrüche – ein Alarmsignal
Die Forderung nach acht Wochen Ferien und die ablehnenden Reaktionen des Gewerbeverbands darauf lassen zumindest den Schluss zu, dass sich hier zwei Sichtweisen auseinanderdividieren.
In der Schweiz werden rund 24% aller Lehrverträge vorzeitig beendet; 2019 betrug die Quote 24,3% (BFS 2023). Erschreckend ist: 62% der Abbrüche erfolgen im ersten Lehrjahr. Das sind Anzeichen eines Systems, das strukturell gefährdet ist – etwa durch falsche Berufswahl, schlechte Unternehmenskulturen, mangelnde Begleitung oder schlicht Überforderung. Könnte es sein, dass sich die Unternehmen zu wenig an die Bedürfnisse der Jugendlichen von heute angepasst haben? Die Forderung nach acht Wochen Ferien und die ablehnenden Reaktionen des Gewerbeverbands darauf lassen zumindest den Schluss zu, dass sich hier zwei Sichtweisen auseinanderdividieren.
Psychosoziale Belastungen und mangelnde Unterstützung
Psychische Belastungen und Überforderung – oft gepaart mit privaten Problemen – nehmen dabei unvermindert zu – sie alle beeinflussen Lehrabbrüche (EHB 2022). Viele Jugendliche sind im Alter von 15 oder 16 Jahren, aus gut behüteten Elternhäusern kommend, schlicht überfordert mit der oftmals rauen Arbeitswelt. In vielen Betrieben fehlt zudem die systematische Unterstützung oder sie steht in Berufsfachschulen nicht niederschwellig zur Verfügung. Überfordern wir unsere Jugendlichen oder ist der gymnasiale Weg einfach bequemer?
Lösungsansätze – wie die Berufsbildung stark bleibt
Unternehmenskultur als Schlüssel
In Betrieben und Schulen gilt es gleichermassen: Wo Angst, Hierarchie und Druck dominieren, wächst kein Vertrauen – und zudem bleibt Innovation aus. Lernende brauchen nebst Anleitung auch Teilhabe, Feedback, Unterstützung und Freiraum. Unternehmen und Branchen, die das ermöglichen, reduzieren Abbrüche und erhöhen Attraktivität (EHB 2022). Allzu oft werden Lernende noch immer als billige Arbeitskräfte, Reinigungskräfte oder Handlanger eingesetzt. Der Fokus auf die Ausbildung und die Wertschätzung der Arbeit bleibt dabei leider zweitrangig. Umgekehrt dürfen die Lehrbetriebe auch Leistung einfordern, insbesondere wenn sie ihrer zentralen Aufgabe als Lernort der praktischen Ausbildung nachkommen.
Image offensiv gestalten
Insbesondere in städtischen Zentren muss die duale Berufsbildung sichtbarer werden und ihre Attraktivität ins Zentrum gestellt werden. Dies kann zum Beispiel durch Netzwerkveranstaltungen, Vorträgen von Vorbildern oder der Kooperation mit Gymnasien und Universitäten geschehen. Ein bisher weitgehend unbearbeitetes Feld sind dabei die Eltern der Jugendlichen. Wenn man das System nicht kennt, steht man ihm auch kritisch gegenüber. Die Kampagnen sollten deshalb auf Jugendliche und Eltern in Städten und Agglomerationen zielen, um das duale System als Karriereweg sichtbar zu machen und Studienalternativen in der höheren Berufsbildung und den Fachhochschulen aufzuzeigen.
Sprachen als Attraktivitätsfaktor
Betriebe sollten Sprache als integralen Bestandteil der Ausbildung fördern und dabei die Sprache als Wertschöpfungsfaktor und Innovationsquelle verstehen.
Die Schweiz ist ein Mehrsprachenland mit vier Amtssprachen und immer öfter Englisch als Geschäftssprache. Sprachkompetenzen sind entscheidend im Arbeitsalltag. Programme wie Erasmus+ oder Movetia ermöglichen zwar Auslandsaufenthalte und fördern Sprach- und interkulturelle Kompetenzen, werden aber von vielen Playern in der Berufsbildung nicht aktiv gefördert. Die meisten Betriebe fokussieren auf das Lernen in der Praxis, da haben zusätzliche Bildungsteile, sei es im Bereich der Sprache, der überfachlichen Kompetenzen oder anderer weiterführender Kompetenzen keinen Platz. Betriebe sollten Sprache als integralen Bestandteil der Ausbildung fördern und dabei die Sprache als Wertschöpfungsfaktor und Innovationsquelle verstehen. Natürlich sind dies weitere Belastungen. Die Alternative dazu ist aber ein weiter steigender Fachkräftemangel, der gravierendere Folgen haben wird als ein strategischer Entscheid zu mehr Investment in die Ausbildung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Innovation willkommen heissen
Die schnell fortschreitenden Innovationszyklen im Bereich der Technologie verändern viele Berufsfelder rasant. Wir müssen sie als Chance begreifen und in Lehr-Lernsituationen integrieren. Berufsfachschulen, überbetriebliche Kurse und Betriebe sollen konsequent mit neuen Tools arbeiten, Fehler als Lernchance akzeptieren und Lernende in Innovation einbeziehen, um Motivation und Praxisreife zu steigern. In den Niederlanden gibt es beispielsweise im Horti Garden Center in Westland eine Berufsfachschule, die die Lernenden an ihren Forschungsarbeiten im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft in High-tech-Greenhouses beteiligt. Sie werden dabei in der Praxis bzw. in der Berufsbildung an Forschung und Weiterentwicklung herangeführt und zudem durch eigene anspruchsvolle Projekte gefordert und gefördert. Müssten wir unseren Lernenden vielleicht mehr zutrauen?
Freiräume, Vertrauen und kollektive Intelligenz
Gute Führung schafft Räume für Dialog, Experiment, Reflexion und Peer-Learning. Lernende sollten bereits früh als vollwertige Mitarbeitende in die Abläufe und Diskussionen einbezogen werden, sei es in den Betrieben, den überbetrieblichen Kurszentren oder in der Berufsfachschule. Wer beteiligt ist entwickelt sich schneller weiter als eine unbeteiligte Person. Anders gesagt: Jugendliche brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können, Vorbilder an denen sie sich orientieren können und Teams, in denen sie sich aufgehoben fühlen.
Vision 2040 – die Berufsbildung als Innovations- und Integrationsmotor
Die Tendenzen, die wir bereits heute erkennen, werden sich bis ins Jahr 2040 verstärkt haben. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Tendenzen zu begegnen und uns weiterzuentwickeln, wird die Berufsbildung an Boden verlieren.
Wenn dies gelingt, werden Lernende den dualen Weg nicht als zweite Wahl erleben, sondern bewusst deshalb wählen, weil er Perspektiven in die Arbeitswelt, Anerkennung und Weiterbildung bietet.
Für Betriebe und Verbände steht dabei im Vordergrund, sich an diese Tendenzen und Entwicklungen anzupassen. Wenn dies gelingt, werden Lernende den dualen Weg nicht als zweite Wahl erleben, sondern bewusst deshalb wählen, weil er Perspektiven in die Arbeitswelt, Anerkennung und Weiterbildung bietet – und dies alles in einer wertschätzenden und bildungsorientierten Arbeitsatmosphäre. Betriebe, überbetriebliche Kurse und Berufsfachschulen kooperieren, sorgen für eine gute Lernkultur und fördern sprachliche und fachliche Vielfalt. Dann wird die schweizerische Berufsbildung weiterhin der zentrale Treiber für Integration, Innovation und nachhaltigen Fortschritt bleiben.
Fazit
Die Berufslehre ist eine der grössten Stärken der Schweiz – innovativ, inklusiv, arbeitsmarktnah. Doch ihr Image leidet, die Zahl der Lehrabbrüche ist hoch, und besonders in Städten wird sie als wenig attraktiv bzw. als zweite Wahl wahrgenommen. Ein Teil der Lösung liegt in der dauerhaften Weiterentwicklung der Strukturen, ein anderer grosser Teil in der Weiterentwicklung der Zusammenarbeitskultur. Gemeint sind damit Lernkulturen, die Vertrauen fördern, Beteiligung stärken, Sprache als Ressource begreifen und Lernende aktiver als heute in betriebliche Experimentierräume einbinden. Solche Lernräume machen die Berufslehre auch zukünftig zu einem Angebot der ersten Wahl. Wenn es gelingt, diese Haltung zu leben, bleibt die Schweiz auch 2040 ein Vorbild für die duale Bildung weltweit.
Quellen
- BFS (2023): Auflösungen von Lehrverträgen in der Schweiz.
- Cedefop (2024): Improving VET image and attractiveness.
- EHB (2022): Projekt Lehrabbruch – Ursachen und Unterstützungsstrategien.
- Movetia (2025): Förderung Austausch und Sprache in der Berufsbildung.
- EHB (2024): Kompetenzzentrum Bili und Sprachen – Bilingualität in der Berufsbildung.
Zitiervorschlag
Hüter, B. (2025). Stark bleiben in einer sich wandelnden Welt. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (11).