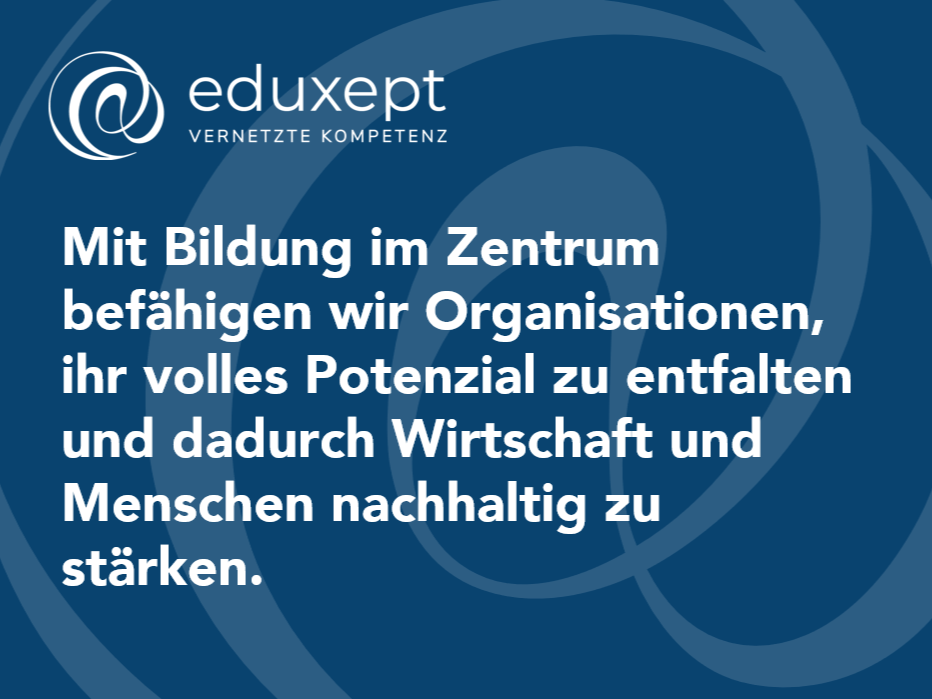Studie der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)
Beschäftigungsfähigkeit und die Rolle der non-formal und informell erworbenen Kompetenzen
Wie gelingt es, ohne Fähigkeitszeugnis oder Diplom beschäftigungsfähig zu bleiben? Eine Studie der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zeigt, dass auch informell und nonformal erworbene Kompetenzen zentrale Ressourcen für die Arbeitsmarktintegration sind. So erwarten drei von vier Betrieben für bestimmte Positionen keinen formalen Abschluss, während Praxiserfahrung und persönliche Eignung unabdingbar erscheinen. Trotzdem werden informell erworbene Kompetenzen häufig übersehen. Die Studie macht deshalb eine Reihe von Vorschlägen, wie Betriebe, Bildung und Politik das Potenzial von Personen ohne formalen Bildungsabschluss noch besser nutzen können.
In Zeiten des demografischen Wandels und zunehmenden Fachkräftemangels rückt eine gesellschaftlich oft marginalisierte Gruppe in den Fokus arbeitsmarktpolitischer und bildungsstrategischer Überlegungen: Personen ohne formalen Bildungsabschluss. Trotz teils langjähriger Berufserfahrung und substanzieller Kompetenzen haben diese Menschen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt strukturell schlechtere Chancen.
Vor diesem Hintergrund führte die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) eine breit angelegte Studie durch und untersuchte, nach welchen Kriterien Unternehmen Personen ohne formale Qualifikation einstellen und wie deren langfristige Arbeitsmarktintegration gelingt. Ein zentrales Anliegen war es, die Rolle von informell und non-formal erworbenen Kompetenzen empirisch zu erfassen und systematisch einzuordnen.
Forschungsdesign und Zielsetzung
Die Untersuchung zielte auf zwei Kernfragen:
- Welche Kriterien kommen bei der Einstellung von Personen ohne formale Qualifikation zur Anwendung?
- Wie gelingt deren nachhaltige und erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt?
Ergänzend wurde analysiert, wie Bewerbungen von Quereinsteigerinnen und -einsteigern bewertet und diese in Unternehmen integriert werden.
Die Studie basiert auf einem Mixed-Methods-Design, bestehend aus einer standardisierten Onlinebefragung von 726 Schweizer Unternehmen verschiedener Branchen und Grössen sowie 22 leitfadengestützten Experteninterviews mit Personalverantwortlichen, Berufsbildnerinnen und Vertretern aus Bildung und Politik.
Die quantitative Erhebung liefert belastbare Einschätzungen zu Rekrutierungsstrategien und Bewertungskriterien bei der Einstellung von Personen ohne formalen Abschluss. Sie erlaubt auch die vertiefte Analyse branchenspezifischer Unterschiede sowie der Perspektiven von Bildungsakteuren und politischen Entscheidungsträgerinnen. Die qualitative Erhebung ermöglicht zudem Einblicke in Entscheidungspraktiken, subjektive Erfahrungen und institutionelle Rahmenbedingungen. Analytisch wurde ein dreidimensionales Modell der Beschäftigungsfähigkeit zugrunde gelegt, das individuelle, betriebliche und institutionelle Einflussfaktoren integriert.
Rekrutierungspraxis und Bewertung informeller Kompetenzen
Umso bemerkenswerter ist, dass 56% der befragten Unternehmen derzeit mindestens eine Person ohne formalen Abschluss beschäftigen, während 39% keine solchen Mitarbeitenden haben.
Die Analyse verdeutlicht, dass informell und non-formal erworbene Kompetenzen ein relevantes, aber oft wenig sichtbares Einstellungskriterium sind. Umso bemerkenswerter ist, dass 56% der befragten Unternehmen derzeit mindestens eine Person ohne formalen Abschluss beschäftigen, während 39% keine solchen Mitarbeitenden haben. In der Gesamtheit aller befragten Firmen zeigt sich, dass zwei Drittel der Unternehmen (67%) deren Kompetenzen als (sehr) wichtig einschätzen. Besonders gefragt sind Soft Skills wie Teamfähigkeit (77%), Zuverlässigkeit (73%) und Lernbereitschaft (69%). Für viele Betriebe steht die Praxistauglichkeit im Vordergrund: Berufserfahrung (65%) und persönliche Empfehlungen (25%) sind für die Anstellung relevanter als Schulnoten (25%) oder formale Diplome (42%). Auffällig ist, dass 73% der Betriebe angaben, für bestimmte Positionen sei kein formaler Abschluss erforderlich, während Praxiserfahrung und persönliche Eignung unabdingbar seien.
Ein noch genaueres Bild ergibt sich, wenn man die Unternehmensgrösse und -branche berücksichtigt. Während in technisch-gewerblichen Branchen und im Bauwesen eine pragmatische Einstellung dominiert, bestehen im öffentlichen Dienst sowie im Gesundheits- und Finanzwesen häufig formale Mindeststandards. Kleinbetriebe greifen eher auf arbeitsnahe Auswahlverfahren wie Probezeiten, Empfehlungen oder Arbeitsproben zurück. Grosse Organisationen hingegen nutzen bei hoher Bewerberanzahl formale Zertifikate häufiger als Filter.
Integration im Betrieb: Praktiken und Herausforderungen
87% dieser Mitarbeitenden werden in regulären Kernfunktionen eingesetzt, was gegen die gängige Annahme spricht, sie seien primär in Hilfstätigkeiten aktiv.
Besonders in jenen Unternehmen, die bewusst Personen ohne formalen Abschluss einstellen, zeigt sich eine Vielfalt an Integrationsstrategien. 87% dieser Mitarbeitenden werden in regulären Kernfunktionen eingesetzt, was gegen die gängige Annahme spricht, sie seien primär in Hilfstätigkeiten aktiv. Anpassungen im Rekrutierungsprozess sind weit verbreitet: 58% der Unternehmen geben an, Verfahren für Bewerber ohne Abschluss anzupassen – etwa durch Probearbeiten, veränderte Gesprächsführung oder durch das zusätzliche Einholen von Referenzen. Häufiger als bei anderen Gruppen setzen diese Betriebe auf strukturierte Einarbeitungspläne oder interne Qualifizierungen.
Gleichzeitig wird aber auch über Defizite insbesondere im Bereich fachlicher und methodischer Kompetenzen berichtet. Besonders in jenen Unternehmen, die bewusst Personen ohne formalen Abschluss einstellen, zeigt sich, dass 85% in diesem Bereich Nachholbedarf sehen, während Sozial- und Selbstkompetenzen deutlich besser bewertet werden. Diese Verteilung unterstreicht, dass informelle Kompetenzen vor allem im Bereich der Soft Skills verortet sind und formale Bildungsabschlüsse oft mit fachlicher Fundierung assoziiert werden.
Eine besondere Gruppe im Kontext informeller Kompetenzen sind Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger – Personen, die nicht mehr in ihrem ursprünglich erlernten Beruf arbeiten und in 76% der befragten Unternehmen anzutreffen sind. Ähnlich wie bei formal niedrig Qualifizierten beruhen ihre Chancen stark auf informell oder non-formal erworbenen Kompetenzen. Knapp 59% der Unternehmen betonen, dass solche Quereinsteiger über übertragbare Fähigkeiten aus früheren Berufen verfügen – etwa Projektmanagement, Problemlösungsfähigkeiten oder Teamarbeit. Für rund ein Drittel der Unternehmen (34%) zählen diese Fähigkeiten sogar zu den wichtigsten Gründen für eine Einstellung. Sie stellen Entwicklungspotenzial statt formaler Passung in den Vordergrund.
Unsichtbarkeit informeller Kompetenzen und symbolische Wirkung von Abschlüssen
In den Interviews berichten viele Personalverantwortliche, dass sie formale Abschlüsse als Beleg für Lernfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sozialisation sehen. Dies führt zu einer systematischen Benachteiligung jener, deren Kompetenzen ausserhalb formaler Bildungswege erworben wurden.
Die qualitative Analyse beleuchtet ein zentrales Spannungsfeld: Die Anerkennung informeller Kompetenzen erfolgt häufig erst dann, wenn formale Bildungsnachweise bereits vorliegen. In den Interviews berichten viele Personalverantwortliche, dass sie formale Abschlüsse als Beleg für Lernfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sozialisation sehen. Dies führt zu einer systematischen Benachteiligung jener, deren Kompetenzen ausserhalb formaler Bildungswege erworben wurden. Die Unsichtbarkeit informeller Stärken wirkt als strukturelle Barriere – auch dort, wo prinzipiell Offenheit besteht.
Darüber hinaus wird deutlich, dass Arbeitgeber informelle Kompetenzen häufig nur konjunkturabhängig anerkennen. In Zeiten des Fachkräftemangels oder bei spezifischen Anforderungsprofilen steigt die Bereitschaft, auf formale Zertifikate zu verzichten. In Phasen mit hoher Bewerberdichte oder in regulierten Berufsfeldern dominieren formale Anforderungen. Diese Selektivität erschwert eine systematische Berücksichtigung informeller Kompetenzen.
Perspektive der Arbeitnehmenden
Viele Personen ohne formale Qualifikation verfügen über substanzielle berufliche Kompetenzen, sei es durch Migration, Care-Arbeit, Ehrenamt oder praktische Erfahrung. Dennoch gelingt es ihnen oft nicht, diese in formalisierte Qualifikationsverfahren einzubringen. Die befragten Experten weisen auf zahlreiche Hürden hin: fehlende Information, mangelnde Beratung, Sprachbarrieren sowie hohe institutionelle Komplexität. Auch fehlt vielerorts das Vertrauen in Anerkennungsverfahren. So entsteht ein Teufelskreis. Informelle Kompetenzen werden nicht nachgewiesen bzw. sichtbar gemacht, also nicht anerkannt – und mangels Anerkennung nicht weiterentwickelt.
Handlungsempfehlungen für Praxis, Bildung und Politik
Auf Basis der Befunde formuliert die Studie differenzierte Empfehlungen entlang von vier Adressatengruppen. Aber es sind Massnahmen auf allen Ebenen erforderlich, um informelle Kompetenzen sichtbar zu machen, anzuerkennen und weiterzuentwickeln.
- Arbeitnehmende
- Unternehmen
- Berufsbildungsorganisationen und
- politische Entscheidungsträger.
Arbeitnehmende benötigen bessere Möglichkeiten, ihre Kompetenzen zu reflektieren und zu dokumentieren. Niederschwellige Formate wie begleitete Portfolioarbeit, Kompetenzbilanzen oder Validierungsberatung können Orientierung und Motivation schaffen. Dabei ist die Förderung einer positiven Bildungshaltung zentral. Viele der befragten Personen erleben formale Bildung als fremd, belastend oder stigmatisierend. Empowerment-Strategien und community-orientierte Lernsettings (z.B. mit niedrigschwelligen Einstiegspunkten oder Peer-Unterstützung) stärken Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Zeitliche Flexibilität, interkulturelle Sensibilität und lebensnahe Inhalte sind dabei ebenso entscheidend wie persönliche Ansprechpersonen.
Unternehmen sind aufgefordert, den Blick über formale Zertifikate hinaus zu öffnen. Eine rekrutierungsbezogene Praxis, die gezielt auf das Potenzial informeller Kompetenzen achtet, erfordert transparente, mehrdimensionale Auswahlverfahren. Dazu gehören Arbeitsproben, mehrstufige Interviews, strukturierte Onboarding-Prozesse oder interne Lernstandserhebungen. Besondere Wirkung entfalten Formate, die Mitarbeitenden eine aktive Teilhabe an ihrer Kompetenzentwicklung bieten – etwa in Form partizipativer Lernziele, Peer-Learning oder Feedbackinstrumente. Zudem sollten HR-Prozesse stärker miteinander verzahnt werden: von der Rekrutierung über das Onboarding bis zur Personalentwicklung. Kompetenzraster oder Lernzielkataloge können helfen, informelle Lernleistungen systematisch zu dokumentieren.
Für Berufsbildungsorganisationen liegt eine zentrale Herausforderung in der Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen informell erworbenen Kompetenzen und formalen Qualifikationen. Modulare Nachqualifikationen, hybride Formate und partielle Anerkennungen ermöglichen einen individualisierten Zugang. Besonders wichtig ist die didaktische und kommunikative Anpassung an bildungsferne Zielgruppen. Dazu gehören vereinfachte Kompetenzraster, handlungsorientierte Validierungsverfahren, Branchenzertifikate sowie digitale Formate wie Selbsttests, Lernjournale oder Peer-Learning-Plattformen. Pilotprojekte zeigen, dass diese Ansätze besonders erfolgreich sind, wenn sie lokal verankert, praxisbezogen und ressourcengerecht begleitet werden.
Neben einer verbesserten Governance im Bereich der Validierung von Bildungsleistungen braucht es eine nationale Koordination, um bestehende, teils fragmentierte, ressourcenintensive und schwer zugängliche Verfahren zu bündeln, Qualität zu sichern und Sichtbarkeit zu schaffen.
Schliesslich sind auch die politischen Entscheidungsträger in Bund und Kantonen in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen für die Anerkennung informeller Kompetenzen zu verbessern. Neben einer verbesserten Governance im Bereich der Validierung von Bildungsleistungen braucht es eine nationale Koordination, um bestehende, teils fragmentierte, ressourcenintensive und schwer zugängliche Verfahren zu bündeln, Qualität zu sichern und Sichtbarkeit zu schaffen – etwa in Form eines zentralen Anerkennungs-Hubs oder digitaler Plattformen. Förderpolitische Instrumente wie Lohnkostenzuschüsse, Mentoringmodelle oder regionale Qualifizierungsfonds können Unternehmen dazu anregen, bildungsferne Personen zu integrieren, während Innovationsfreiräume genutzt werden sollten, um neue Validierungsformate zu erproben.
Dabei sind branchenspezifische Unterschiede zu berücksichtigen: In regulierten Bereichen, in denen formale Abschlüsse zwingend sind, sollten begleitende Qualifizierungs- und Nachweispfade entwickelt werden, während in weniger regulierten Branchen die direkte Kompetenzvalidierung stärker zum Einsatz kommen kann. Für spezifische Zielgruppen wie Migrantinnen, ältere Arbeitnehmer oder Langzeitarbeitslose sind passgenaue Unterstützungsformate erforderlich, die sprachliche, kulturelle und biografische Besonderheiten einbeziehen. Ergänzend wird der Ausbau arbeitsmarktnaher Pilotprojekte – etwa regionaler Kompetenzzentren – sowie deren gezielte Skalierung empfohlen. Eine systematische Wirkungsmessung mit klar definierten Kennzahlen ist notwendig, um die Qualität und den Nutzen von Validierungsverfahren kontinuierlich zu sichern. Flankierend sollten breit angelegte Informations- und Sensibilisierungskampagnen das öffentliche Bewusstsein für den Wert informeller Kompetenzen stärken und bestehende Vorurteile abbauen. Erfolgreiche Praxisbeispiele, sektorübergreifende Netzwerke, digitale Wissensplattformen oder politische Anerkennungsinstrumente sollten im Vordergrund stehen, um die Bedeutung informell erworbener Kompetenzen für den Arbeitsmarkt sichtbar zu machen.
Fazit: Sichtbarkeit schafft Beschäftigungsfähigkeit
Die Studie zeigt, dass non-formal und informell erworbene Kompetenzen ein zentrales, bislang unzureichend genutztes Potenzial bei der Rekrutierung in einem sich wandelnden Arbeitsmarktes sind. Die systematische Anerkennung dieser Kompetenzen erfordert jedoch nicht nur technische Lösungen, sondern auch einen kulturellen Wandel. Arbeitgeber, Bildungsinstitutionen und Politik sind gefordert, neue Brücken zu bauen – zwischen biografischem Lernen und formaler Qualifikation, zwischen Praxis und Zertifikat, zwischen Potenzial und Anerkennung. Beschäftigungsfähigkeit entsteht nicht allein durch formale Ausbildungen, sie wächst auch im Alltag, im Betrieb und in der Vielfalt individueller Lebenswege. Wer diese Vielfalt sichtbar macht, erweitert nicht nur Teilhabechancen; er stärkt auch die Zukunftsfähigkeit eines inklusiven Arbeitsmarkts.
Damit dieser Prozess gelingt, gilt es vier Grundprinzipien zu berücksichtigen. Erstens müssen alle Massnahmen in das Gesamtsystem der Berufsbildung eingebettet bleiben, damit die bewährte duale Ausbildung nicht geschwächt, sondern gezielt ergänzt wird. Zweitens ist Sprachkompetenz ein zentraler Schlüssel für Arbeitsmarktintegration und Weiterbildung und sollte in allen Massnahmen gefördert werden. Drittens gilt das Prinzip «Kein Abschluss ohne Anschluss»: Jeder erreichte Zwischenschritt muss Anschlussmöglichkeiten eröffnen und nachhaltige Perspektiven schaffen. Und viertens bleibt die formale Berufsausbildung mit eidgenössischem Abschluss das Fundament des Systems, auf dem zusätzliche non-formale Qualifikationen sinnvoll aufbauen können.
Der Bericht kann heruntergeladen werden auf: https://2leadership.ch/
Zitiervorschlag
Imboden, S. & Glatzl, E. (2025). Beschäftigungsfähigkeit und die Rolle der non-formal und informell erworbenen Kompetenzen. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (14).