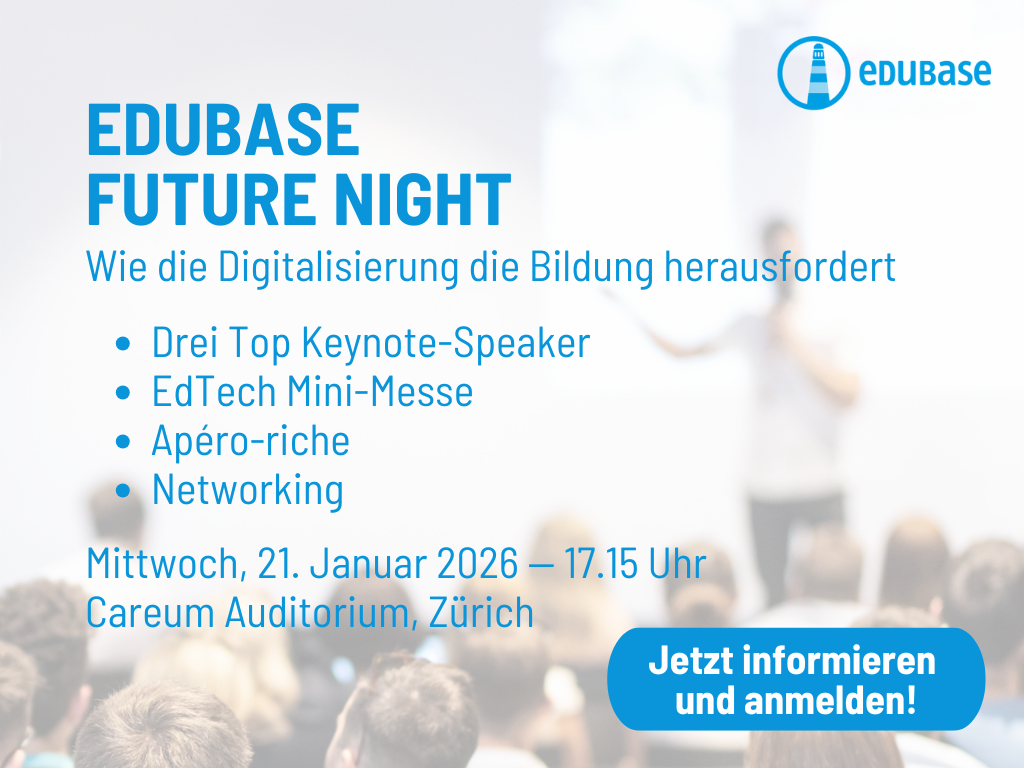Das Projekt «Digitale Begleitung im Berufswahlprozess» (digibe)
Die Berufswahl ist kein linearer Prozess
Berufsorientierung ist mehr als Informationsvermittlung oder die Suche nach der «richtigen» Anschlusslösung. Sie ist ein Lern- und Entwicklungsprozess – eine Phase, die Reflexion und Unterstützung verlangt. Die Fachhochschule Nordwestschweiz und die Pädagogische Hochschule Bern haben dafür das Hilfsmittel digibe konzipiert, das die Jugendlichen unterstützen soll, reflexive Fähigkeiten zu entwickeln, unterschiedliche Eindrücke zu verarbeiten, Ziele zu setzen oder Entscheidungen vorzubereiten. Eine Evaluation des Instruments zeigt gute Ergebnisse. digibe sollte aber systematisch in den Unterricht eingebunden und differenziert genutzt werden.
Die oft nur kurze Zeitspanne, in der die Berufswahl thematisiert wird, führt für die Schülerinnen und Schüler zu einem dichten Programm und gönnt ihnen relativ wenig Zeit für die Exploration von Alternativen.
Die schulische Berufsorientierung auf der Sekundarstufe I verfolgt mehrere Ziele: Einerseits sollen Jugendliche eine passende Anschlusslösung nach der obligatorischen Schule finden. Andererseits geht es darum, sie langfristig zu befähigen, ihre schulische und berufliche Laufbahn selbstständig zu gestalten (Lehrplan 21; D-EDK, 2016).
In der Praxis überwiegt häufig das erste Ziel. Viele Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, rasch einen möglichst direkten Übergang in eine zertifizierende Ausbildung sicherzustellen. Der zweite Anspruch, die Förderung einer nachhaltigen Auseinandersetzung mit Interessen, Stärken, Werten und Entscheidungsstilen, gerät leicht in den Hintergrund. Genau hier setzt das Forschungsprojekt «Digitale Begleitung im Berufswahlprozess» (digibe) an, das digitale Reflexionsaufgaben bereitstellt und untersucht, ob diese im schulischen Kontext die berufliche Reflexionsfähigkeit von Jugendlichen stärken können.[1]
Die Suche nach der passenden Anschlusslösung
Die schulische Berufsorientierung findet in der Deutschschweiz oft geballt im ersten Semester des achten Schuljahres statt, typischerweise in einer Wochenlektion. Die oft nur kurze Zeitspanne, in der die Berufswahl thematisiert wird, führt für die Schülerinnen und Schüler zu einem dichten Programm und gönnt ihnen relativ wenig Zeit für die Exploration von Alternativen.
Eine Antwort auf diese Herausforderung ist die Steuerung, Strukturierung und Vereinfachung des Prozesses. So gibt es Initiativen, die durch Tests, den Beizug von Noten, standardisierte Leistungstests oder Anforderungsprofile versuchen, eine Passung zwischen Schülerinnen und Lehrberufen herzustellen (Rüfenacht, 2020). Es erfolgt auch eine teilweise implizite Triage, indem sich Schüler mit guten Noten und dem Ziel Mittelschule wenig in die Berufswahl investieren. So sehen wir in unserem Projekt Informationssetting Basel-Landschaft, dass Schülerinnen mit guten Noten und dem Ziel Fachmittelschule vielfach nur stereotype und wenig reflektierte Vorstellungen der beruflichen Grundbildung haben (Nägele & Düggeli, 2021). Sie müssen sich mit der Berufsbildung nicht weiter auseinandersetzen. Ebenso erhielten wir im Rahmen von digibe Rückmeldungen von Lehrern, dass die berufliche Orientierung bei ihnen kein Thema sei, da ihre Schülerinnen den Notenschnitt für den Übertritt ans Gymnasium erreichen würden und die Berufswahl der wenigen anderen Schülerinnen in der Verantwortung der Eltern liege. Es erfolgt auch eine Vor-Selektion von Informationen, z.B. durch Eltern, Lehrpersonen und andere Akteurinnen; oder eine Reduktion der Komplexität, indem die berufliche Orientierung als linear fortschreitender Prozess aufgefasst wird, wie er durch die kantonalen Berufsbildungsfahrpläne nahegelegt wird. Die Sequenz ist typischerweise so:
- Interessen, Stärken, Fähigkeiten kennenlernen,
- die Berufswelt kennenlernen,
- entscheiden,
- die Entscheidung umsetzen.
Wir sehen aber, dass Schüler ihre Berufswahl pausieren, Neues ausprobieren, Entscheide verwerfen und sich verändern und entwickeln.
Wir sehen aber, dass Schüler ihre Berufswahl pausieren, Neues ausprobieren, Entscheide verwerfen und sich verändern und entwickeln. Ebenso lässt sich kein Zeitpunkt finden, an dem z.B. die Beschäftigung mit den eigenen Interessen für alle Jugendlichen das aktuelle Thema ist. So kann es vorkommen, dass sich eine Schülerin zuerst überlegt, für welche berufliche Grundbildung sie sich bewerben möchte, ohne zuvor die Frage gestellt zu haben, was sie interessiert.
Ergebnisse
Nun könnte man mit Blick auf die Bildungsstatistik argumentieren, dass die gemeinsamen Anstrengungen von Schülerinnen und Schülern, Schulen, Eltern und der Arbeitswelt dazu führen, dass 78 Prozent der Jugendlichen direkt und 93 Prozent innerhalb von drei Jahren in eine zertifizierende Ausbildung auf Sekundarstufe II übertreten (BFS/OFS/UFS, 2025). Zudem zeigt auch das Nahtstellenbarometer immer wieder eine hohe Zufriedenheit mit der Anschlusslösung (gfs.bern AG, 2025).
Andererseits aber folgt die Schul- und Berufswahl seit Jahren konsistent starken sozialen oder gendertypischen Mustern (Hupka-Brunner & Meyer, 2023; Makarova, 2019). Familiale Faktoren und das Umfeld beeinflussen die Berufswahl stark, unabhängig von den Fähigkeiten und dem Potenzial eines Schülers (Maschetzke, 2009). Auch kleinräumliche Strukturen können Bildungsentscheidungen stark beeinflussen (Niedermann, 2023). Das meritokratische Prinzip, wonach Leistung ausschlaggebend für Bildungsentscheidungen sein soll, wird zwar hochgehalten; in der Praxis aber zeigt sich ein anderes Bild.
Die Lernenden sind bei Beginn der beruflichen Grundbildung zufrieden und es geht vielen auch in deren Verlauf gut (Schmocker et al., 2025). Für den Einstieg wesentlich ist die soziale Integration in den Betrieb (Nägele & Neuenschwander, 2014). Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der beruflichen Grundbildung branchenspezifisch eine hohe Rate von Lehrvertragsauflösungen gibt (BFS/OFS/UFS, 2023) und es zu Um- und Neuorientierungen kommt (Stalder & Schmid, 2016). Ebenso schliessen weniger als drei Viertel der Schülerinnen die gymnasiale Ausbildung auf direktem Weg ab (SKBF, 2023). Es kommt zu Repetition, 14 Prozent brechen das Gymnasium ganz ab.
Dies führt unweigerlich zur Frage, ob überhaupt die «richtigen» Schüler in der «richtigen» Ausbildung auf der Sekundarstufe II finden.
Laufbahnbildung
Die Planung der Laufbahn ist ein komplexer, auch emotionaler Prozess. Grundsätzlich sollte ein Ziel der beruflichen Orientierung auch sein, die Schüler zu befähigen, ihre Laufbahngestaltung selbstständig an die Hand zu nehmen.
Die berufliche Orientierung auf der Sekundarstufe I sollte deshalb nicht nur als Praxis der Zuweisung zu einer nachobligatorischen Ausbildung verstanden werden, sondern vermehrt auch als Befähigung, die eigene Laufbahn zu gestalten. Es ist also ein Lern- und Entwicklungsprozess, der immer die Person, die Umwelt und die Relation von Person und Umwelt, insbesondere auch soziale und familiale Beziehungsaspekte, umfasst. In diesem Spannungsfeld entwirft die Person ihre Laufbahnplanung und Lebensgeschichte dynamisch und kontextabhängig (Guichard, 2022; Savickas et al., 2009). Die Planung der Laufbahn ist ein komplexer, auch emotionaler Prozess (Hellberg, 2009). Grundsätzlich sollte ein Ziel der beruflichen Orientierung auch sein, die Schüler zu befähigen, ihre Laufbahngestaltung selbstständig an die Hand zu nehmen.
Die berufswahlbezogene Reflexion wird damit zentral. Sie ist eine unabdingbare metakognitive Kompetenz der Laufbahnplanung (Marciniak et al., 2021; Musset & Kurekova, 2018). Reflexion stellt hohe Anforderungen an das Individuum. Eine Schülerin muss bereit sein, eigene Sichtweisen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern. Gerade im schulischen Kontext ist die berufswahlbezogene Reflexion innerhalb der vorgegebenen curricularen Strukturen jedoch kein Selbstläufer (Hell, 2023), sondern muss aktiv angeregt und strukturiert werden (Bührmann et al., 2023). Reflexion ist eine Voraussetzung für die Entwicklung neuer Perspektiven auf die eigene Laufbahn, im Sinne transformativer Lernprozesse (Mezirow, 2009). Gerade in Zeiten, in denen Erwerbsverläufe weniger linear verlaufen und Jugendliche vermehrt Bildungswechsel oder Umorientierungen erfahren, gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung.
Dabei kommt den Lehrerinnen eine wichtige Rolle zu. Sie sehen sich selbst als Instruktor, Vermittlerin von Informationen, Berater, Unterstützerin oder als Koordinator aller involvierter Akteurinnen (Stalder et al., 2023). Gleichzeitig stehen ihnen für diese Aufgaben oft nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung.
Reflexion mit digitalen Werkzeugen
Vor diesem Hintergrund haben wir die «Digitale Begleitung im Berufswahlprozess» (digibe) entwickelt; es ist eine Online-Sammlung von Reflexionsaufgaben.
Vor diesem Hintergrund haben wir die «Digitale Begleitung im Berufswahlprozess» (digibe) entwickelt; es ist eine Online-Sammlung von Reflexionsaufgaben (Nägele, Stalder, et al., 2025), die die Schülerinnen anregen, vertieft über ihre Laufbahnplanung nachzudenken und etwa ihre Interessen frei zu beschreiben (Hänni et al., under review), über den Einfluss ihres sozialen Umfelds nachzudenken oder sich Gedanken zu machen, wie sie Erfahrungen und Fähigkeiten in Computerspielen auf die Schul- und Berufswahl übertragen könnten (Hoffelner et al., 2025).
In digibe wählen die Schüler je nach Stand ihrer Berufswahl die Reflexionsaufgabe selbst. Die Aufgaben sind adaptiv und individuell bearbeitbar. Statt eine konkrete Anschlusslösung zu ermitteln, regen sie zur Auseinandersetzung mit eigenen Vorstellungen, Wünschen und Werten an. Die Aufgaben sind didaktisch strukturiert: Einführung, Bearbeitung, Rückmeldung, Reflexion, Zusammenfassung.
Die Forschungsfrage ist, ob ein solches digitales Werkzeug zu einer Verbesserung der beruflichen Reflexion beitragen kann. Sie bildete den Gegenstand der Feldphase des Projekts (2021 bis 2024). Die Fortschritte bei der Berufsorientierung wurden bis zu dreimal pro Semester gemessen, was im genannten Zeitraum zu achtzehn Beobachtungen führte, die die Klassenstufen 9 bis 11 abdecken. Innerhalb von zwei Jahren sank die Zahl der Teilnehmenden von 2’848 auf 702; im dritten Jahr waren noch 150 Schüler übrig. Dieser Rückgang war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die allermeisten Schülerinnen am Ende der 9. Klasse ihre weiteren Pläne festgelegt hatten und nicht mehr an Reflexionsaufgaben arbeiteten oder über ihren Stand der Berufswahl Auskunft gaben. Dazu kamen weitere Faktoren wie Schulabgänge, Klassenwechsel, Personalwechsel oder der Rückzug von Lehrpersonen aus dem Projekt. Forschungsmethodisch stellte dabei die Flexibilität der Bearbeitung der Reflexionsaufgaben grosse Herausforderungen, da die Schülerinnen zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlich oft daran arbeiten.[2]
- Die bisherigen Ergebnisse zeigen erstens, dass digitale Reflexionsaufgaben die Reflexionsfähigkeit von Jugendlichen tatsächlich fördern können (Nägele et al., under review; Nägele, Wyss, et al., 2025). Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung alternativer Sichtweisen auf die Schul- und Berufswahl. Es lohnt sich also, sich mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen. Dies gilt allerdings nur, wenn die Schüler bereit sind, sich überhaupt mit Fragen der Berufswahl auseinanderzusetzen. Manche empfinden die Aufgaben als bereichernd, andere sehen wenig Relevanz in ihnen. Dies verweist auf die Wichtigkeit der Berufswahlbereitschaft.
- Zweitens zeigt sich, dass es nicht besser ist, mehr Aufgaben zu lösen. Vielmehr leidet die berufliche Reflexionsfähigkeit sogar bei einer zu häufigen Bearbeitung der Aufgaben. Diese Effekte sind unabhängig vom Geschlecht oder der Klassenzugehörigkeit.
- Drittens zeigen die Auswertungen, dass Berufsorientierung kein linearer Prozess ist. Viele Jugendliche wechseln ihre Vorstellungen mehrmals, setzen Reflexionsphasen aus und kehren später zurück. Dies stellt hohe Anforderungen an die schulische Berufsorientierung, die individuell, flexibel und kontinuierlich gestaltet sein muss.
- Viertens spielen Lehrpersonen eine wichtige Rolle: Sie ermöglichen den Zugang zum Tool, motivieren zur Auseinandersetzung und begleiten den Prozess. Entscheidend ist, dass sie Freiräume schaffen, differenzieren und Reflexion als pädagogisches Ziel ernst nehmen. Dafür brauchen sie jedoch Unterstützung – sei es durch Fortbildungen, Materialien, Werkzeuge und durch Ressourcen wie Zeitgefässe.
Wir arbeiten zurzeit auch daran, die Reflexionsaufgaben (eingebettet in ein pädagogisch-didaktisches Konzept) interessierten Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen.
Digibe ist ein Forschungsprojekt und es sind einige Publikationen in der Pipeline. Wir arbeiten zurzeit auch daran, die Reflexionsaufgaben (eingebettet in ein pädagogisch-didaktisches Konzept) interessierten Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen. Es interessiert uns, wie sich die Reflexionsaufgaben bewähren und im Unterricht eingesetzt werden können. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer wenden sich bitte direkt an Christof Nägele (christof.naegele@me.com), um Möglichkeiten des Einsatzes zu besprechen.
Praxis Schul- und Berufsorientierung
- Reflexionszeit einplanen: Schulen sollten umfangreiche Zeiten für berufsbezogene Reflexion einplanen – auch ausserhalb der praktisch vorzufindenden Berufswahlphase im ersten Semester des 8. Schuljahres.
- Verankerung im Schulcurriculum: Berufsorientierung sollte systematisch auch im Fachunterricht integriert werden – etwa durch thematische Anknüpfungen in Deutsch, Wirtschaft, Arbeit und Haushalt (WAH) oder Räume, Zeiten, Gesellschaften (RZG). Dies eröffnet erweiterte Reflexionsmöglichkeiten.
- Digitale Tools systematisch integrieren: Tools wie digibe sollten im Unterricht integriert werden.
- Reflexion differenzieren: Lehrpersonen sollten flexibel entscheiden können, wann welche Aufgaben für welche Schülerinnen sinnvoll sind – z B. basierend auf ihren Interessen oder dem Berufswahlstand.
- Feedbackkultur stärken: Rückmeldungen zu Reflexionen (auch durch Peers oder Eltern) fördern die Auseinandersetzung und erhöhen die Wirksamkeit.
- Kooperation fördern: Eine enge Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Berufsberatung, Eltern und Betrieben stärkt die Wirkung schulischer Berufsorientierung.
- Übergänge begleiten: Die Anschlussfähigkeit zur Berufsfachschule, zu überbetrieblichen Kursen oder Brückenangeboten sollte durch gezielte Kooperationen unterstützt werden.
Steuerung Schul- und Berufsorientierung
- Verstärkte Koordination mit der Berufsbildung: Schulische Berufsorientierung und betriebliche Ausbildungsrealitäten sollten stärker aufeinander abgestimmt werden – etwa durch gemeinsame Weiterbildungen von Lehrerinnen und Berufsbildungsverantwortlichen.
- Ressourcen für individualisierte Begleitung: Der Anspruch, alle Jugendlichen individuell zu begleiten, ist mit den heutigen Ressourcen kaum zu erfüllen. Es braucht gezielte Investitionen in persönliche Unterstützung.
- Frühe Orientierung ohne Druck: Die frühzeitige Berufsorientierung sollte reflexiv und offen gestaltet sein – nicht als vorzeitige Festlegung, sondern als Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung.
- Digitale Innovationen fördern: Die Entwicklung, Evaluation und Verbreitung digitaler Tools für die Berufsbildung sollte gezielt gefördert werden, insbesondere mit Blick auf heterogene Zielgruppen.
- Integration in kantonale Berufsbildungsstrategien: Die schulische Berufsorientierung muss Bestandteil langfristiger Berufsbildungsplanung auf kantonaler Ebene sein, auch unter Einbezug der Wirtschaft.
Literatur
- BFS/OFS/UFS. (2023). Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus. Resultate zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ). Bundesamt für Statistik (BFS).
- BFS/OFS/UFS. Übergang in die Sekundarstufe II.
- Bührmann, T., Dumstrei, F., & Oppermann, M. (2023). Evaluation des Modellvorhabens zur Erprobung von Reflexionsgesprächen in der Beruflichen Orientierung in Schleswig-Holstein. Medical School Hamburg, University of Applied Sciences and Medical University.
- D-EDK. (2016). Lehrplan 21: Gesamtausgabe [Curriculum 21: Complete edition]. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK.
- gfs.bern AG. (2025). Nahtstellenbarometer 2025. Cockpit gfs.bern AG.
- Guichard, J. (2022). Support for the design of active life at a turning point. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 133–146.
- Hänni, N., Hell, B., Pässler, K., & Nägele, C. (under review). Berufliche Interessen Jugendlicher: Eine Analyse offener Interessenäußerungen [Vocational Interests of youth: An analysis of openly expressed interests]. Under Review.
- Hell, B. (2023). Konstruktion fächerübergreifender Self-Assessments: Möglichkeiten und Herausforderungen. Tagung Online-Self-Assessments: Quo vadis, 9.-10.11.2023, Mannheim, DE.
- Hellberg, B.-M. (2009). Entscheidungsfindung bei der Berufswahl—Prozessmodell der Emotionen und Kognitionen. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hoffelner, C., Nägele, C., & Düggeli, A. (2025). Play for the future: A cross-sectional study on the role of video game skills in student career planning. Simulation & Gaming.
- Hupka-Brunner, S., & Meyer, T. (2023). Gegenderte Lebensläufe in der Schweiz: Befunde aus der TREE-Studie (TREE Working Paper Series No. No. 7; pp. 1–14). TREE.
- Makarova, E. (Ed.). (2019). Gendersensible Berufsorientierung und Berufswahl. hep verlag ag.
- Marciniak, J., Hirschi, A., Johnston, C. S., & Haenggli, M. (2021). Measuring career preparedness among adolescents: Development and validation of the career resources questionnaire – adolescent version. Journal of Career Assessment, 29(1), 164–180.
- Maschetzke, C. (2009). Die Bedeutung der Eltern im Prozess der Berufsorientierung. In M. Oechsle, H. Knauf, C. Maschetzke, & E. Rosowski, Abitur und was dann? (pp. 181–228). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mezirow, J. (2009). An overview on transformative learning. In K. Illeris (Ed.), Contemporary theories of learning: Learning theorists … In their own words (pp. 90–105). Routledge.
- Musset, P., & Kurekova, L. M. (2018). Working it out: Career guidance and employer engagement (OECD Education Working Papers No. 175; OECD Education Working Papers, Vol. 175).
- Nägele, C., & Düggeli, A. (2021). Getting into VET and designing one’s career in VET. In C. Nägele, B. Stalder, & M. Weich (Eds), Pathways in vocational education and training and lifelong learning. Proceedings of the 4th Crossing Boundaries Conference in vocational education and training, Muttenz and Bern online, 8. 9. April: Vol. IV (pp. 259–266). PH FHNW, PHBern, VETNET.
- Nägele, C., & Neuenschwander, M. P. (2014). Adjustment processes and fit perceptions as predictors of organizational commitment and occupational commitment of young workers. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 385–393.
- Nägele, C., Stalder, B. E., Hell, B., Hoffelner, C., & Pässler, K. (2025). Reflexionsaufgaben in www.digibe.ch [Reflection tasks in www.digibe.ch]. PH FHNW, PH Bern, APS FHNW.
- Nägele, C., Wyss, A., Hell, B., & Stalder, B. (under review). Supporting career self-awareness through online reflection: A longitudinal study in natural school contexts.
- Nägele, C., Wyss, A. M., Hell, B., & Stalder, B. E. (2025). Online tools to support career planning on the pathway to vocational education and training (VET) or general education. In E. Quintana-Murci, F. Salvà-Mut, B. E. Stalder, & C. Nägele (Eds), Towards inclusive and egalitarian vocational education and training: Key challenges and strategies from a holistic and multi-contextual approach. VETNET/OAPublishing.
- Niedermann, S. (2023). Bildungsteilhabe und Raum: Zur Standortabhängigkeit schulischer Selektion in der Schweiz. Beltz Juventa.
- Rüfenacht, K. (2020). Anforderungsprofile.ch: Schulische Instrumente für die Berufswahl und -vorbereitung (p. 27) [Anforderungs-profile.ch: School tools for career choice and preparation]. Generalsekretariat EDK, Koordinationsbereich II «Berufsbildung und Sekundarstufe II / Allgemeinbildung».
- Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239–250.
- Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Transfer. Psychische Gesundheit in der Berufslehre. Transfer.
- SKBF. (2023). Bildungsbericht Schweiz 2023. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Stalder, B. E., Gaupp, P.-M., & Nägele, C. (2023). Teachers and their role in the career choice process. In C. Nägele, N. Kersh, & B. E. Stalder (Eds), Trends in vocational education and training research (Vol. 6). VETNET/OAPublishing.
- Stalder, B. E., & Schmid, E. (2016). Lehrvertragsauflösung und Ausbildungserfolg – Kein Widerspruch. Wege und Umwege zum Berufsabschluss [Apprenticeship contract termination and training success – no contradiction. Direct and indirect paths to occupational qualifications]. hep verlag.
Zitiervorschlag
Nägele, C., Stalder, B. E., & Wyss, A. (2025). Die Berufswahl ist kein linearer Prozess. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (13).