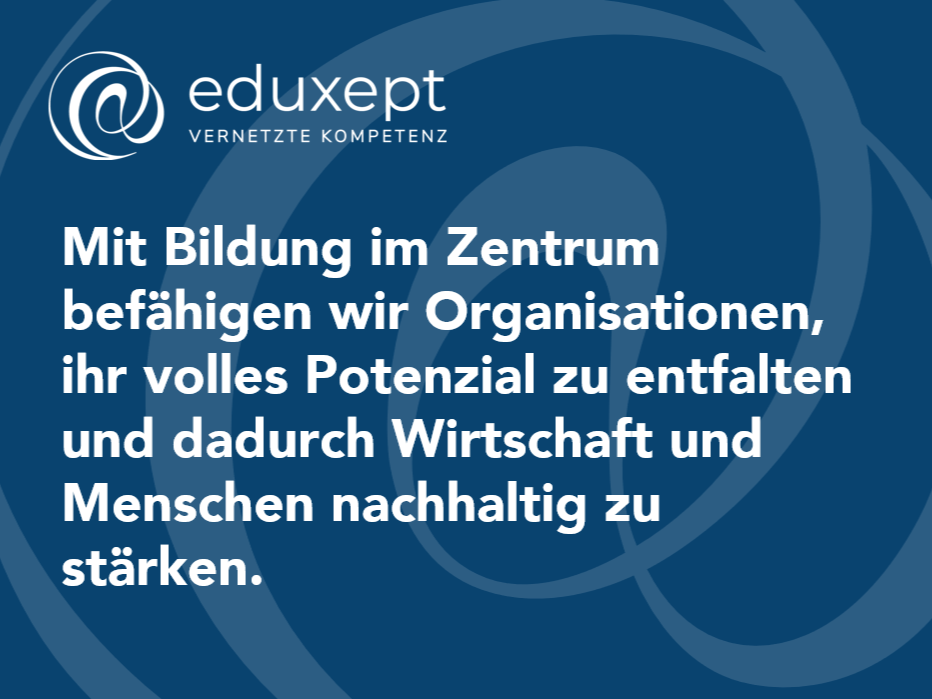Befragung der Lernenden in der Schweiz, Teil 2: Wie erleben die Lernenden ihre Ausbildung?
Viele sind herausgefordert, nur wenige überfordert
Die berufliche Grundbildung ist ein zentraler Baustein des Schweizer Bildungssystems – und für die meisten Jugendliche der erste Schritt in die Arbeitswelt. Doch wie erleben die Lernenden selbst diese prägende Lebensphase? Dies ist die zentrale Frage der Studie «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre». Ihre Autoren fassen die wichtigsten Ergebnisse in vier Beiträgen zusammen, die Transfer publiziert. Der vorliegende, zweite Text geht der Frage nach, welchen Herausforderungen die Jugendlichen in der Lehre begegnen, was sie stärkt und was sie belastet.
Weiter berichtet ein Grossteil, dass sie die Lehre meist als spannend empfinden, stolz sind, in ihrem Lehrbetrieb zu arbeiten und auch das Gefühl haben, einer sinnvollen Arbeit nachzugehen. Beinahe 90% der Lernenden zeigen sich mit ihrem gewählten Lehrberuf zufrieden.
Die Lehre wird insgesamt von der grossen Mehrheit positiv erlebt: Drei Viertel der Lernenden geben an, dass es ihnen in der Lehre gut bis sehr gut geht. 56% würden ihren Lehrbetrieb ohne Einschränkungen weiterempfehlen. Die am häufigsten genannten Gründe für eine Weiterempfehlung sind ein unterstützendes Team (48%), eine angenehme Arbeitsatmosphäre (25%) und ein qualitativ guter Ausbildungsort (17%). 33% der Lernenden hingegen würden ihren Lehrbetrieb nur bedingt und 11% nicht weiterempfehlen (mehr zu den Gründen unten). Weiter berichtet ein Grossteil, dass sie die Lehre meist als spannend empfinden, stolz sind, in ihrem Lehrbetrieb zu arbeiten und auch das Gefühl haben, einer sinnvollen Arbeit nachzugehen. Beinahe 90% der Lernenden zeigen sich mit ihrem gewählten Lehrberuf zufrieden. Das sind erfreuliche Ergebnisse.
Angaben zur Studie
Im Rahmen der Studie «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre. Biografie, Belastung, Wachstum und Erfolgsfaktoren von Lernenden in der dualen Berufsbildung in der Schweiz» wurden im Winter 2024/25 Lernende der Schweiz befragt. Die Antworten von rund 45’000 Jugendlichen aus allen Sprachregionen waren auswertbar – eine hinsichtlich Teilnahme und Vertiefung einzigartige Datengrundlage. Erfasst wurde, wie die Lernende ihre Ausbildung erleben, was sie motiviert und stärkt, aber auch, was sie belastet. Zudem wurde erhoben, wie sie ihre psychische Gesundheit einschätzen und welche familiären, sozialen oder schulischen Faktoren damit zusammenhängen. Die Studie wurde durchgeführt von WorkMed AG, einem Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit, das sich in Praxis und Forschung mit Arbeit und psychischer Gesundheit beschäftigt.
Weitere methodische Angaben finden sich im ersten in Transfer publizierten Beitrag.
Der Lehrstart
Die grosse Mehrheit der Lernenden hat sich bewusst für den aktuellen Lehrberuf entschieden, hat sich für die Lehre bereit gefühlt und sich darauf gefreut. Lediglich für 18% war die aktuelle Lehrstelle eine Notlösung. Häufige Gründe für Vorfreude sind:
- Wunsch, Geld zu verdienen (88%)
- Möglichkeit, einer interessanten Tätigkeit nachzugehen (83%)
- Selbstständigkeit und Eigenverantwortung übernehmen (81%)
- etwas Sinnvolles tun (81%).
Neben dieser Vorfreude machen sich viele aber auch Sorgen, besonders häufig aus folgenden Gründen:
- Überforderung bei schulischen Aufgaben (63%)
- Arbeitszeiten und Ferien (63%)
- fehlendes Verständnis für Fehler / Schwierigkeiten (60%)).
Lernende erleben sich als selbstwirksam
In Anbetracht der grossen Veränderung und damit einhergehender Unsicherheit sind diese Sorgen nachvollziehbar und «normal». Trotz dieser Bedenken kommen die Lernenden gemäss Umfrage aber sehr gut mit der neuen Situation zurecht: Insgesamt denken beinahe alle Lernenden (90%), dass sie mit den Herausforderungen der Lehre ziemlich bis sehr gut umgehen können, sich also als selbstwirksam erleben. Auch die erhobene «berufliche Selbstwirksamkeit» wird von den Lernenden positiv eingeschätzt. Über 80% der Lernenden stimmen der Aussage eher oder ganz zu, dass sie den Anforderungen der Ausbildung gewachsen sind und die Fähigkeiten haben, die gefordert sind. Diese Zahlen sind deutliche Hinweise auf eine grossmehrheitlich starke Resilienz der Lernenden. Das Erleben von Selbstwirksamkeit wächst zudem im Verlauf der Lehre.
Zudem beschreibt eine deutlich kleinere, aber ernstzunehmende Gruppe von Lernenden auch, den Schwierigkeiten in der Lehre weniger gelassen entgegenzusehen und ihren Problemlösefähigkeiten weniger zu vertrauen.
Es sind jedoch Geschlechterunterschiede erkennbar: männliche Lernende weisen höhere Werte in ihrer Selbstwirksamkeit wie auch in ihrem Kontrollgefühl auf als weibliche Lernende. Zudem beschreibt eine deutlich kleinere, aber ernstzunehmende Gruppe von Lernenden auch, den Schwierigkeiten in der Lehre weniger gelassen entgegenzusehen und ihren Problemlösefähigkeiten weniger zu vertrauen.
Die Betriebe können einiges machen, um die die Zuversicht der Lernenden zu fördern: Eine enge Begleitung am ersten Tag zum Beispiel erleichtert den Lernenden den Einstieg in den neuen Lebensabschnitt. Auch ein Willkommenstag und ein fixes Einführungsprogramm erlebten die Lernenden als hilfreich. Etwa ein Drittel der Lernenden nahm an einem Anlass mit den Eltern teil – allerdings nicht immer mit Begeisterung: Elternanlässe werden von den Lernenden im Verhältnis als am wenigsten nützlich erachtet. Hier zeigt sich eine Diskrepanz zwischen der Perspektive der Lernenden und den Berufsbildenden. Für die Berufsbildenden sind die Eltern oder nahe Bezugspersonen besonders wichtig, v.a. dann, wenn es Schwierigkeiten im Lehrverlauf gibt: Eine grössere Präsenz und Unterstützung der Eltern ist ihr am häufigsten geäusserte Bedarf (Schmocker et al., 2022).
Sehr starke persönliche Entwicklung durch und mit der Lehre
Eines der wichtigsten und in diesem Ausmass nicht erwartetes Ergebnis ist die sehr starke, breite und positive persönliche Entwicklung, die die Lernenden in der Lehre machen. Rund 80-90% der Lernenden erleben sich seit Lehrbeginn als verantwortungsbewusster, fleissiger, ehrgeiziger, sozialkompetenter und kompetenter. Zudem gibt eine grosse Mehrheit an, dass sich ihr Durchhaltewille verbessert hat. Beeindruckend ist auch: rund die Hälfte der Lernenden sind motivierter, am Morgen aufzustehen als noch während der Schulzeit – obwohl bei der Mehrheit der Lernenden der Wecker wohl früher klingelt. Unter dem Gesichtspunkt, dass sich der innere Rhythmus von Jugendlichen verändert – sie werden abends später müde und wollen dafür morgens länger schlafen (Liamlahi, Hug & Benz, 2019) – ist dieses Resultat ein sehr deutlicher Ausdruck für die Motivation der Lernenden. Von den vorgegebenen 15 möglichen Fortschritten seit Lehrbeginn erleben die Lernenden im Schnitt in zwölf Bereichen (grosse) Fortschritte. Die Resultate unterstreichen, dass die Lehre für die Jugendlichen eine enorme Chance ist und sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich wachsen. Auch Basler und Kriesi (2022) weisen nach, dass Lernende in ihrer persönlichen Entwicklung von der Lehre profitieren.
Die Resultate zeigen, dass 55% der männlichen Lernenden und 72% der weiblichen Lernenden eine tiefere Kontrollüberzeugung haben als die Schweizer Bevölkerung.
Auch die Kontrollüberzeugung wurde erhoben. Darunter wird das Ausmass verstanden, in dem eine Person glaubt, dass das Auftreten eines Ereignisses in ihrem Leben abhängig von ihrem Verhalten ist (Rotter, 1966). Je ausgeprägter die Kontrollüberzeugung ist, desto stärker ist das Vertrauen der Person in ihre Fähigkeit, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und desto seltener berichtet sie von psychischen Belastungen. Umgekehrt fühlen sich Personen eher ausgeliefert und hilflos, wenn sie glauben, dass es egal ist, was sie machen, es ändert sowieso nichts – das kann psychisch belasten. Die Resultate zeigen, dass 55% der männlichen Lernenden und 72% der weiblichen Lernenden eine tiefere Kontrollüberzeugung haben als die Schweizer Bevölkerung. Dies überrascht insofern nicht, da Lernende im Vergleich zu Erwachsenen über weniger Erfahrung im eigenständigen Entscheiden und Handeln haben, da viele Entscheidungen noch von Eltern, Lehrpersonen oder Ausbildenden getroffen werden. In der Lehre bewegen sie sich zudem je nach Situation in einem mehr oder weniger hierarchisch geprägten Umfeld mit begrenztem Handlungsspielraum. Diese Abhängigkeit sowie das sich noch entwickelnde Selbstkonzept können dazu führen, dass Lernende ihre Einflussmöglichkeiten als geringer einschätzen und eine tiefere Kontrollüberzeugung besitzen.
Die Lehre kann anstrengend sein
Zum einen berichten die Lernenden demnach sehr häufig über ein äusserst positives Erleben der Lehre, zum anderen aber bestehen oft auch Sorgen, Ängste oder psychische Probleme. Auf die summarische Frage, wie sich die Lehre insgesamt auf das Befinden auswirkt, nannte die Hälfte der Lernenden einen positiven Effekt, ein Drittel einen negativen Effekt, 15% sehen keinen Einfluss. Was steckt dahinter? Die neuen Anforderungen in der Lehre (die neuen Präsenzzeiten, das Einfinden in der «Erwachsenenwelt» und in der neuen Rolle, neue Anforderungen an die Selbstorganisation oder die Erwartungen resp. Anforderungen der verschiedenen Lernorte) und die Reduktion der Freizeit sind für Lernende einschneidend und erklären vielleicht, weshalb sie die Auswirkungen der Lehre auf ihr Befinden negativ erleben. Über die Hälfte der Lernenden investiert in der Freizeit mehrmals pro Woche in schulische Aufgaben wie Lernen oder Arbeiten schreiben. Im Vergleich zur Zeit vor der Ausbildung reduzieren etwa 40% der Lernenden ihre Freizeitaktivitäten.
Rund die Hälfte der Befragten hat sich mindestens einmal überlegt, die Lehre abzubrechen. Die Lernenden denken v.a. über den Lehrabbruch nach, weil sie sich überfordert fühlen und sie das Gefühl haben (oder man ihnen das Gefühl gibt), dass sie nichts können.
Rund die Hälfte der Befragten hat sich mindestens einmal überlegt, die Lehre abzubrechen. Die Lernenden denken v.a. über den Lehrabbruch nach, weil sie sich überfordert fühlen und sie das Gefühl haben (oder man ihnen das Gefühl gibt), dass sie nichts können. Als weiterer wichtiger Grund werden zwischenmenschliche Schwierigkeiten genannt: Probleme mit Berufsbildnerinnen, Lehrern oder ein geringes Wohlbefinden in Team/Klasse. Lernende, die sich von ihrem Berufsbildner unterstützt fühlen, ziehen wesentlich seltener in Erwägung, ihre Lehre abzubrechenDies verdeutlicht die Wichtigkeit der Arbeitsbeziehung zwischen den Berufsbildenden und den Lernenden; zudem erweist sich die Arbeitsatmosphäre im Allgemeinen als zentraler Faktor.
Aber weshalb brechen Lernende, welche sich Gedanken über einen Lehrabbruch machen, die Lehrenicht ab? Die grosse Mehrheit (81%) bricht nicht ab, weil sie nicht aufgeben will. Nicht aufgeben wollen, etwas «durchziehen», ist grundsätzlich eine sehr positive Haltung und ein zentraler Faktor für die Resilienz. Neben dem «eigenen Willen» kann jedoch auch das soziale Umfeld entscheidend sein,. So hilft es vielen Lernenden, wenn jemand an sie glaubt, sie ermutigt oder wenn die Eltern die Erwartung haben, dass die Lernenden weitermachen. Dies gilt erst recht bei Lernenden mit einem niedrigen Selbstwert, die an sich zweifeln und sich wenig zutrauen.
Beziehungen und die Atmosphäre im Betrieb sind entscheidend
In der Studie kristallisierte sich heraus, dass insbesondere die zwischenmenschlichen Beziehungen resp. das soziale Umfeld eine wichtige Rolle dafür spielen, wie es den Lernenden in der Lehre geht und wie sie die Ausbildung erlebten. Allgemein unterstreichen die Resultate den Einfluss guter Beziehungen im Arbeitskontext: Eine grosse Mehrheit ist zufrieden mit ihren Berufsbildnerinnen (81%). Dies zeigt sich vor allem darin, dass sich die Lernenden gut fachlich unterstützt und auch ernstgenommen fühlen. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich bzgl. der Klassenlehrpersonen in der Berufsfachschule. Die Lernenden treffen in den Lehrbetrieben auch grossmehrheitlich (über 80%) einen freundlichen und respektvollen Umgang an, sie werden gefördert und erleben einen guten Zusammenhalt. Das Erleben der Lernenden bestätigt damit auch die Einschätzung verschiedener Studien, die den Berufsbildnerinnen in der Regel eine hohe Motivation und Engagement in der Begleitung der Lernenden attestieren (vgl. Egger et al., 2024, Schmocker et al, 2022).
Auch die Begründungen der Lernenden, warum ein Lehrbetrieb weiterempfohlen wird, unterstreichen dies. Ausschlaggebend sind vor allem ein unterstützendes Team und die Arbeitsatmosphäre. Beispielhafte Aussagen dafür sind: «Sehr gutes Umfeld, alle sind sehr nett, man kann immer nachfragen, wenn etwas nicht klar ist.» oder «Der Berufsbildner ist sehr nett und erklärt mir alles genau und erklärt es mir auch mehrmals, wenn ich es noch nicht verstehe.» (Originaltexte aus dem Freitextfeld).
Neben den Berufsbildenden leisten auch die übrigen Mitarbeitenden im Team einen sehr wichtigen Beitrag dazu, dass die Ausbildung von den Lernenden positiv erlebt wird.
Demgegenüber wird der Betrieb gar nicht oder nur bedingt empfohlen, wenn Mitarbeitende als unfreundlich und aggressiv empfunden werden. Beispiele dafür sind: «Mein Chef hat starke Stimmungsschwankungen», «Viele lästern hintenrum, man kann keinem vertrauen» oder «Toxisches Umfeld (Angeschrien von der Chefin, Alkoholkonsum während der Arbeit etc.) und schnell sehr viel Verantwortung (zu viel für jemanden in der Lehre).» (Originaltexte aus dem Freitextfeld). Neben den Berufsbildenden leisten auch die übrigen Mitarbeitenden im Team einen sehr wichtigen Beitrag dazu, dass die Ausbildung von den Lernenden positiv erlebt wird. Wie geht das Team miteinander um? Besteht ein freundlicher und respektvoller Umgang? Wie ist das Arbeitsklima? Werden Lernende ernstgenommen?
So positiv die allgemeine Wahrnehmung ist, so sticht ein Beziehungsaspekt heraus, der vergleichsweise deutlich negativer bewertet wird: Ein Viertel der Lernenden hat das Gefühl, dass sich die Berufsbildenden nicht dafür interessieren, wie es ihnen geht (bei den Lehrpersonen in der Berufsfachschule sind es gar 45%) und 23% der Lernenden glauben, dass die Berufsbildenden (bei den Lehrpersonen sind es 37%) sie nicht unterstützt würden, wenn es ihnen nicht gut geht. Wenn es also um persönliche Themen und Probleme der Lernenden geht, sind die Verantwortlichen weniger spürbar. Dies kann mit den Unsicherheiten der Berufsbildenden im Zusammenhang stehen: sie sind besonders häufig unsicher, wenn es um «psychische» Themen geht – auch wenn sie schon über viel Berufserfahrung verfügen. (Schmocker et al. 2022). Gleichzeitig wenden sich Lernende selten (in 30% der Fälle) an ihre Lehrverantwortlichen, wenn es ihnen nicht gut geht oder sie erwägen, die Lehre abzubrechen. D.h. von beiden Seiten besteht eine Zurückhaltung, wenn es um persönliche resp. psychische Themen geht. Es fragt sich also, ob die verbreitete Meinung, dass die «Jungen» ganz anders mit dem Thema psychische Belastungen umgehen, wirklich zutrifft. Zumindest für den Ausbildungs- resp. Arbeitskontext scheint die Hürde, über psychische Probleme zu sprechen, weiter zu bestehen.
Impulse für die Praxis
- Lehrbeginn: Enge Begleitung in den ersten Wochen und Integration ins Team.
- Interesse zeigen: Eine Präventionsmassnahme, die im Alltag für alle anwendbar ist und viel bewirken kann.
- Respektvoll bleiben: Auf freundliche Arbeitsatmosphäre achten. Anschreien ist tabu.
- Selbstwirksamkeit stärken: Lernenden ermutigen, etwas zu wagen, ihnen etwas zutrauen, an sie glauben, sie bestärken, dranzubleiben, auch wenn es mal schwierig ist – aber achtsam sein gegenüber Anzeichen von Überforderung.
- Gutes Lernklima schaffen: Eine offene Fehlerkultur vorleben, offene Tür bei Unsicherheiten, Problemen, Nachfragen.
Quellen
- Basler, A., & Kriesi, I. (2022). Die Veränderung informeller Kompetenzen zwischen dem Ende der obligatorischen Schulzeit und dem frühen Erwachsenenalter. Swiss Journal of Sociology, 48(2), 285-315.
- Egger, T., Lamamra, N., & Gonon, P. (2024). Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungswünsche von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.
- Liamlahi, R., Hug, M., & Benz, C. (2019, 8. Mai). Schlafberatung bei Jugendlichen. pädiatrie schweiz. Abgerufen am [heutiges Datum], von
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28.
- Schmocker, B., Kuhn, T., Frick, U., Schweighauser, C., Baumgartner, R. Diesch, R., Ettlin, P., Frei, A., & Baer, N. (2022). Umgang mit psychisch belasteten Lernenden – Eine Befragung von Berufsbildner*innen in der Deutschschweiz. Binningen: WorkMed.
- Schuler, D., Tuch, A., Buscher, N., & Camenzind, P. (2016). Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring 2016 (Obsan Bericht 72). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
Zitiervorschlag
Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Viele sind herausgefordert, nur wenige überfordert. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (12).