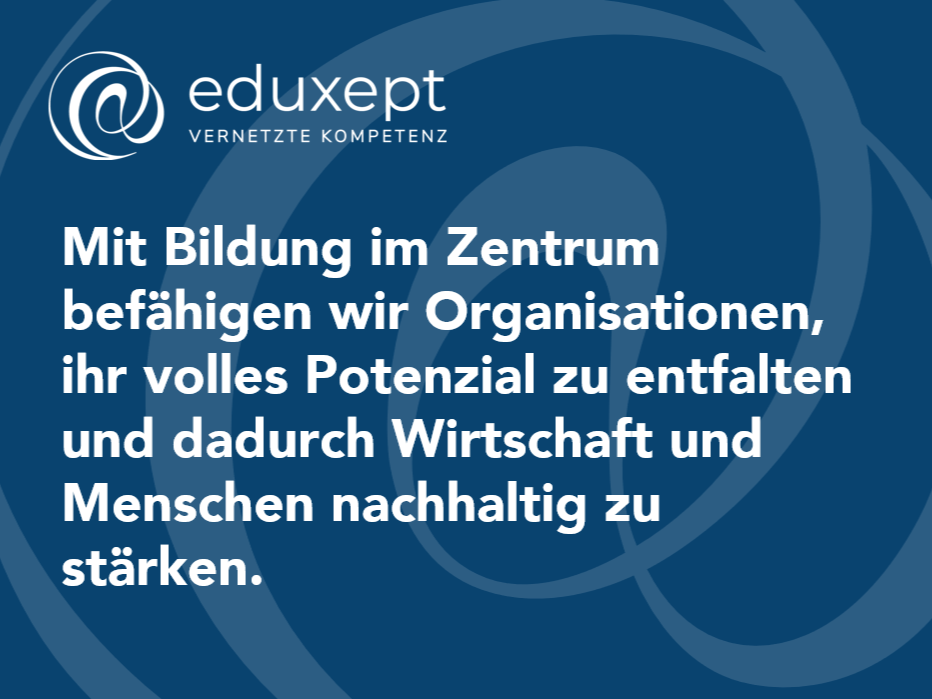Neues Buch im hep Verlag
Die Arbeit hinter den Kulissen der Schweizer Berufsbildung
Sie haben während 30 Jahren einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Berufsbildung in der Schweiz gehabt: Christine Davatz (Schweizerischer Gewerbeverband) und Bruno Weber-Gobet (TravailSuisse). Die beiden Persönlichkeiten stehen im Zentrum einer Publikation, die zwei Dinge leistet: Sie rekonstruiert die wichtigsten Etappen der Entwicklung der Berufsbildung der jüngeren Vergangenheit. Und sie macht die Arbeit hinter den Kulissen der Schweizer Berufsbildung sichtbar. Im vorliegenden Text konzentriert sich der Autor des Buches, Lorenzo Bonoli, auf den zweiten Bereich und erklärt, warum es Lobbyisten wie Davatz und Weber-Gobet braucht.

Bruno Weber-Gobet und Christine Davatz anlässlich der Buchpräsentation im Juni 2025. Bild: EHB/Ben Zurbriggen
In den letzten Jahren hat die Schweizer Berufsbildung auf internationaler Ebene viel Beachtung erhalten. Zahlreiche Delegationen besuchten unser Land, um die Mechanismen zu verstehen, die unser Modell der dualen Berufsbildung so erfolgreich machen.
Die Erfahrungen mit internationalen Kooperationsprojekten zeigen allerdings, wie schwierig oder gar unmöglich es ist, unser Modell in andere Länder zu übertragen. Für diese Schwierigkeiten gibt es mehrere Gründe. Sie reichen von sozioökonomischen Faktoren über rechtliche und gesetzliche Zwänge bis hin zu unterschiedlichen Traditionen oder Auffassungen von Berufsbildung.
Ein erheblicher Teil der Diskussionen, Verhandlungen und Beschlüsse, die die Berufsbildung ausmachen, erfolgt in informellen Kontexten, sozusagen hinter den Kulissen des Systems.
Besonders schwer zu replizieren ist dabei eine Besonderheit unseres dualen Bildungssystems: wie Entscheidungen zustande kommen. Ein erheblicher Teil der Diskussionen, Verhandlungen und Beschlüsse, die die Berufsbildung ausmachen, erfolgt in informellen Kontexten, sozusagen hinter den Kulissen des Systems. Dieser verborgene Teil der Schweizer Berufsbildungspolitik sichert ihr Funktionieren, ihre Nähe zu den Anforderungen vor Ort, ihre politische Umsetzbarkeit. Er ist leider kaum an andere Orte zu übertragen, schon allein deshalb, weil er selbst in der Schweiz so wenig bekannt ist.
Im Fokus zwei Fachleute der Berufsbildung
Diese Überlegungen ergeben sich aus einer kürzlich erschienenen Publikation «Die Arbeit hinter den Kulissen».[1] Sie rekonstruiert anhand von Interviews mit zwei Figuren der Schweizer Berufsbildung die Entwicklung der Berufsbildung seit den 1990er-Jahren und beleuchtet die Bedeutung der Arbeit hinter den Kulissen. Diese beiden Figuren sind Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet, zwei prägende Persönlichkeiten der Schweizer Berufsbildung in den letzten 30 Jahren. Anlass für die Publikation war ihre Pensionierung.
Ein kurzer Blick auf die von den beiden Akteuren ausgeübten Funktionen zeigt ihre zentrale Bedeutung. Christine Davatz war
- stellvertretende Direktorin des Schweizerischen Gewerbeverbands und zuständig für Bildungspolitik
- Mitglied der Expertenkommission zur Vorbereitung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung von 2002
- Mitglied der Eidgenössischen Berufsbildungskommission
- Mitglied der Schweizerischen Hochschulkonferenz und des Schweizerischen Hochschulrats
- Mitglied des Fachhochschulrats der Fachhochschule FHNW
- Mitglied der Expertengruppe für Bildungsfragen im Bundesamt für Statistik
- Mitglied der Qualitätssicherungskommission des Vereins «Bildung Führungskräfte Gewerbe Schweiz»
- Vizepräsidentin der Organisation der Arbeitswelt «Bildung Detailhandel Schweiz»
- Präsidentin der «Interessengemeinschaft Kaufmännische Grundbildung Schweiz»
- Präsidentin der Schweizerischen Stiftung des Registers der Privatschulen in der Schweiz und
- Präsidentin des Netzwerks der KMU-Frauen Schweiz.
Diese Liste könnte verlängert werden. Der Werdegang von Bruno Weber-Gobet ist ebenfalls bemerkenswert. Er war (und auch diese Liste ist nicht erschöpfend):
- verantwortlich für die Bildungspolitik beim Christlichen Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG), heute Travail.Suisse
- Direktor des Ausbildungsinstituts für Angestellte ARC
- Mitglied der Expertenkommission zur Vorbereitung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung von 2002
- Mitglied der Eidgenössischen Berufsbildungskommission
- Mitglied der Eidgenössischen Fachhochschulkommission
- Mitglied der vorparlamentarischen Kommission für die Teilrevision des Fachhochschulgesetzes
- Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung
- Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung
- Vorstandsmitglied der Konferenz der Höheren Fachschulen.
Die Einsitznahme in so vielen Kommissionen und Organisationen macht Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet zu besonders interessanten Gesprächspartnern, wenn man die Entwicklung der Schweizer Berufsbildung der letzten Jahre besser verstehen möchte. Anhand ihrer Auskünfte lassen sich die Herausforderungen, die Positionierungen und die Verhandlungen, die zu bestimmten Entscheidungen führten, gut erfassen. Dies tut die vorliegende Publikation. Sie geht dabei auf Schlüsselaspekte der Entwicklung der Berufsbildung seit den 1990er-Jahren ein: von der Lehrstellenkrise bis zur Entwicklung der Berufsmaturität und der Fachhochschulen in den 1990er-Jahren; vom Berufsbildungsgesetz 2002 bis zum Weiterbildungsgesetz 2014; von den Herausforderungen der allgemeinen Steuerung der Schweizer Berufsbildung bis zu den spezifischeren Herausforderungen etwa der Berufsberatung oder der Höheren Berufsbildung.
Governance der Berufsbildung braucht informelle Gefässe
Parallel dazu ermöglichen die Interviews mit den beiden Akteuren ein besseres Verständnis der Funktionsweise der «Governance» der Berufsbildung und der Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wird. Diese bildet den Gegenstand der weiteren Ausführungen an dieser Stelle. Die beiden Funktionslisten, die wir gerade erwähnt haben, zeigen die Rolle, die die beiden Akteurinnen gespielt haben, ihre Anwesenheit bei den meisten wichtigen Treffen, bei denen über die Zukunft der Berufsbildung diskutiert wurde. Sie zeugen von einem grossen Kontaktnetz und einer umfassenden Expertise, die sie sich in vielen Jahren der Tätigkeit angeeignet haben und die sie zu unverzichtbaren Gesprächspartnern gemacht haben.
Andererseits werfen die beiden Listen auch Fragen bezüglich der Macht auf, die Akteurinnen wie Christine Davatz oder Bruno Weber-Gobet in der politischen Arena ausüben konnten und können.
Andererseits werfen die beiden Listen auch Fragen bezüglich der Macht auf, die Akteurinnen wie Christine Davatz oder Bruno Weber-Gobet in der politischen Arena ausüben konnten und können. Diese Macht liegt im Schatten, hinter den Kulissen. Sie liefert Informationen in die Politik und stellt die Verbindung zwischen der Politik und dem Feld der Berufsbildung sicher. Aber sie beeinflusst zugleich Entscheidungen im Sinne der Interessen, die von den Organisationen, in denen sie über mehrere Jahrzehnte beschäftigt waren, vertreten wurden.
Diese Konstellation ist im politischen System der Schweiz nicht ungewöhnlich, im Gegenteil: Sie ist Ausdruck der Beteiligung von Interessengruppen am Gesetzgebungsprozess. Diese erfolgt auf unterschiedliche Weise, von der Teilnahme von Vertretungen bestimmter Interessengruppen in ausserparlamentarischen Kommissionen bis hin zur Lobbyarbeit bei den gewählten Parlamentarierinnen.[2]
Die Präsenz von Interessengruppen im politischen Prozess ist im Bereich der Berufsbildung besonders ausgeprägt. Das Bundesgesetz sieht ausdrücklich die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Akteuren (Bund und Kantone) und privaten Akteuren (Organisationen der Arbeitswelt) vor (vgl. Art. 1, BBG 2002). Die «Verbundpartnerschaft», ein Ausdruck, der zur Bezeichnung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren verwendet wird, bietet die Möglichkeit, die Logik des Einflusses privater Interessengruppen innerhalb der Governance der Berufsbildung zu formalisieren. Sie erlaubt, die Art und Weise, wie diese Logik der Einflussnahme verwirklicht wird, zumindest teilweise zu erklären und zu regulieren, indem eine Reihe von Entscheidungskompetenzen explizit dem einen oder anderen Akteur zugewiesen wird.
Hinter dieser expliziten Zuweisung von Zuständigkeiten basiert die Steuerung des Systems, im Weiteren aber auch auf einer Reihe von weniger formalisierten Aktivitäten. Die Komplexität des Schweizer Berufsbildungssystems mit seiner relativ grossen Anzahl von Akteuren erfordert zwingend informelle Aktivitäten der Information, Diskussion, Verhandlung und Kompromissfindung. Emmenegger und Seitzl unterstreichen in ihrem Bericht über die «Systemische Steuerung der Schweizer Berufsbildung» die Bedeutung dieser informellen Aktivitäten; sie verwenden dabei den Begriff der «dezentralen Kooperation» (S. 8). Eine solche dezentrale Kooperation ist unerlässlich, um die für das reibungslose Funktionieren des Systems notwendige Koordination sicherzustellen. Dieses System kann angesichts der Anzahl der Akteure und ihrer jeweiligen Blockademacht nur dann funktionieren, wenn einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Dafür sind eine umfangreiche Informations-, Beratungs-, Diskussions- und Verhandlungsarbeit sowie – bei Entscheidungen auf politischer Ebene – die Suche nach Kompromissen unerlässlich.
Christine Davatz sagt: «Im Bereich der Berufsbildung sind wir auf Gedeihe und Verderb zur Zusammenarbeit verdammt».
Auf dieser Ebene entfaltet sich die Arbeit von Akteuren wie Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet. Ihre Arbeit ist ganz natürlich von bestimmten Interessen geprägt, sie muss aber auch offen sein für die Suche nach Kompromissen. Christine Davatz sagt: «Im Bereich der Berufsbildung sind wir auf Gedeihe und Verderb zur Zusammenarbeit verdammt».
Problematische Machtballungen
Diese Koordinationsarbeit, so der Bericht von Emmenegger und Seitzl weiter, findet zum Teil auch ausserhalb offizieller Strukturen statt, die durch gesetzliche Bestimmungen geregelt sind. In einem solchen Kontext können informelle Beziehungen eine sehr wichtige Rolle spielen, insbesondere durch das Engagement einzelner Akteure, die von ihrer zentralen Position innerhalb der verschiedenen Netzwerke der Berufsbildung profitieren. Dies führt dazu, dass «letztlich […] eine geringe Anzahl von Personen, die oftmals mehrere Aufgaben auf sich vereinen, die zentrale Rolle in der systemischen Steuerung der Berufsbildung» spielen (ebd, S. 30). Eine solche Rolle spielten genau Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet. Aber der Bericht identifiziert in dieser Abhängigkeit von einzelnen Akteuren auch eine Schwäche der systemischen Governance der Schweizer Berufsbildung. Denn mit dem Rückzug dieser Personen besteht die Gefahr, dass solche informellen und personalisierten Entscheidungsprozesse nicht mehr funktionieren. Trotz dieser Kritik erkennt der Bericht an, dass diese Konstellation einer begrenzten Anzahl sehr einflussreicher Personen es dem System in den letzten Jahren ermöglicht hat, zahlreiche konsensfähige Lösungen zu finden und damit «eine besonders wichtige Beteiligung an der systemischen Steuerung der Berufsbildung» sicherzustellen» (S. 30).
Darüber hinaus ist anzumerken, dass eine solche Situation zwangsläufig Fragen hinsichtlich ihrer Transparenz aufwirft, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf den Entscheidungsprozess. Denn es kostet natürlich Geld, sich die Dienste einer Person zu sichern, die diese Arbeit erledigt. So beschäftigt nur eine kleine Anzahl von Interessengruppen für diese Tätigkeiten Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit.
Für die anderen müssen vorübergehende Lösungen gefunden werden, um dennoch zum richtigen Zeitpunkt auf der politischen Bühne präsent zu sein. Diese Lösungen können sehr aufwendig sein: Eine kürzlich ausgestrahlte Sendung der SRS über Lobbyismus in der Schweiz im Allgemeinen zeigt, dass die Beauftragung einer Kommunikationsagentur, um während der parlamentarischen Sitzungen einen Lobbyisten in Bern zu haben, bis zu 2000 CHF pro Tag kosten kann.[3]
Trotz dieser problematischen Aspekte haben Lobbyisten auch positive Seiten, die sie zu unumgänglichen Figuren in der Schweizer Politik machen. In ihrer Arbeit stellen sie de facto eine Verbindung zwischen der Politik und der Praxis her, in unserem Fall der Welt der Berufsbildung. Mit anderen Worten: Dank der Arbeit dieser Akteure kann die Politik sicher sein, dass sie über alle notwendigen Informationen verfügt, bevor sie neue Bestimmungen erlässt. Und auf der anderen Seite können die verschiedenen Interessengruppen durch ihre Arbeit dazu beitragen, dass die Politik ihre Forderungen ausreichend berücksichtigt. Im Zentrum des Lobbyismus steht die Spannung zwischen Informieren und Beeinflussen – eine Spannung, die ethische und politische Fragen aufwirft, die besonders schwer zu entwirren sind.
Davatz und Weber-Gobet: Experten-Lobbyisten
Denn zu den Schwierigkeiten, mit denen einige ausländische Berufsbildungssysteme zu kämpfen haben, gehört genau das Fehlen solcher Expertenfiguren, die lange im Fachgebiet bleiben und als Bindeglied zwischen der Praxis und der Politik agieren.
Es ist jedoch zu beachten, dass wir es im Fall von Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet mit zwei Lobbyisten mit besonderen Merkmalen zu tun haben. Ihre lange Präsenz in diesem Bereich hat es ihnen ermöglicht, ein breites Fachwissen anzueignen und so zu «Experten-Lobbyisten» zu werden, die über die Sphären ihrer Interessengruppen hinaus anerkannt und gehört wurden. Diese Expertise scheint wesentlich für die Positionierung der beiden Personen zu sein – für die Möglichkeit, systematisch zu den wichtigsten Treffen eingeladen zu werden und für ihre Glaubwürdigkeit und Autorität bei der Suche nach Kompromissen.
Um den eingangs eröffneten Kreis zu schliessen: Die Bedeutung der Arbeit hinter den Kulissen, die von solchen Expertenlobbyisten geleistet wird, lässt sich am besten aus einer internationalen Perspektive beurteilen. Denn zu den Schwierigkeiten, mit denen einige ausländische Berufsbildungssysteme zu kämpfen haben, gehört genau das Fehlen solcher Expertenfiguren, die lange im Fachgebiet bleiben und als Bindeglied zwischen der Praxis und der Politik agieren. Solche Persönlichkeiten sind auch ausserhalb ihrer Interessengruppen anerkannt und sind wegen ihres Fachwissens und ihrer Bereitschaft, gemeinsam an Kompromissen zu arbeiten, gefragt. Ohne solche Figuren fehlt auch der vorparlamentarische und vorpolitische Diskussionsraum. Er bildet den Hintergrund der partnerschaftlichen Berufsbildungspolitik in der Schweiz, den «harten Kern» unseres Systems, der so schwer auf andere Länder übertragbar ist. Von diesem informellen Diskussionsraum profitierten Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet – und sie halfen zugleich, ihn zu pflegen.
Lorenzo Bonoli (2025): Die Arbeit hinter den Kulissen. 30 Jahre Berufsbildungspolitik. Im Gespräch mit Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet. hep verlag, Bern. Mitglieder der SGAB erhalten das Buch zum Vorzugspreis von CHF 30.40 statt CHF 36.00. Portokosten CHF 7.50. Bestellungen bitte an Jonas Probst.
[1] Bonoli, L. (2025). Die Arbeit hinter den Kulissen. 30 Jahre Berufsbildungspolitik im Gespräch mit Christine Davatz und Bruno Weber-Gobet. hep. Weitere Informationen [2] cf. Vatter, A. (2014). Das politische System der Schweiz. Nomos Verlag UTB, pp. 189 ss. [3] Vgl. Sendereihe «Lobbyland» von SRF vom 21.08.23 bis 07.09.2023. Vgl. zudem die Sendungen von RTS Vacarme zum Thema «Lobbying» vom 03. bis 09.02.2000.Literatur
- Emmenegger, P., Seitzl, L (2019): Expertenbericht zur systemischen Steuerung der Berufsbildung in der Schweiz. Im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
- Vatter, A. (2014). Das politische System der Schweiz. Nomos Verlag UTB.
Zitiervorschlag
Bonoli, L. (2025). Die Arbeit hinter den Kulissen der Schweizer Berufsbildung. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (12).