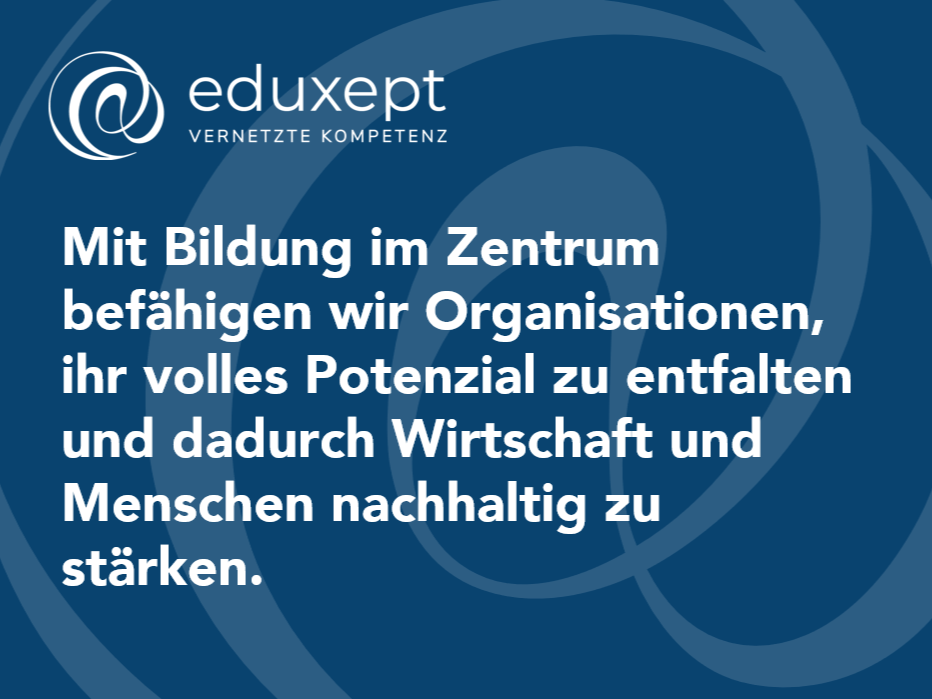Dieter Euler
Der Zweck heiligt den Optimismus – Berufswahl zwischen Herkunft und Zukunft
Wer seinen Beruf wählt, trifft eine der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens. Aber diese Wahl ist selten frei und selbstbestimmt, denn Herkunft, soziale Bedingungen und regionale Gegebenheiten prägen die Berufswahl tiefgreifend. Der Optimismus, dass Jugendliche mit Schulabschluss eine klare, stabile Entscheidung treffen, wird durch die Realität relativiert. Vielmehr ist die Berufswahl oft von Unsicherheiten, Kompromissen und fortwährender Neuorientierung geprägt – denn der Zweck heiligt den Optimismus, aber die Zukunft bleibt plural.
Junge Menschen aus sozial benachteiligten Familien weisen geringere berufliche Ambitionen auf als Jugendliche aus sozioökonomisch privilegierten Elternhäusern.
Zugespitzt liesse sich die Wahl eines Berufs neben der Wahl des Lebenspartners als die wichtigste Lebensentscheidung eines Menschen bezeichnen. Sie wird Jugendlichen in einer Phase ihres Lebens abverlangt, die für sie mehr durch offene Fragen als durch klare Antworten geprägt ist. Dabei sind die Erwartungen an eine Berufswahl hoch. So formulierte der Aktionsrat Bildung für junge Menschen das Bildungsziel der «beruflichen Souveränität (als) die Möglichkeit und Kompetenz einer Person, ihren Beruf selbstbestimmt zu wählen und auszuüben» (Aktionsrat Bildung, 2023, S. 55). In der Konkretisierung umfasst die Berufswahlkompetenz u.a. die «Entscheidungsfähigkeit bei der Berufswahl auf der Grundlage einer realistischen Einschätzung der Möglichkeiten im Abgleich mit eigenen Wünschen».
Sind die Erwartungen realistisch oder zu optimistisch? Wird hier nicht das Unmögliche gefordert und dadurch das Mögliche verhindert? Ignoriert dieser Anspruch nicht die Tatsache, dass der Blick auf die Zukunft massgeblich durch die Herkunft beeinflusst wird?
Für eine Antwort auf diese Fragen hilft zunächst ein Blick auf den Erkenntnisstand über den Berufswahlprozess. Eine Übersicht erzielt man, indem man einiges übersieht – daher in der gebotenen Kürze: Die berufliche Orientierung wird zumeist als ein individueller, lebenslanger Entwicklungsprozess verstanden, in dem eigene Interessen, Wünsche und Kompetenzen mit den Anforderungen der Arbeitswelt abgeglichen werden. Dieser Prozess vollzieht sich in unterschiedlicher Form und Intensität in verschiedenen Lebens- und Bildungsphasen. Gegen Ende der Schulzeit sollen sich die Aspirationen mit Unterstützung schulischer und ausserschulischer Angebote so weit konkretisieren, dass eine (erste) Entscheidung über eine Berufslehre bzw. ein Studium getroffen wird. Im Idealfall hat sich ein berufliches Selbstkonzept herausgebildet, das dem jungen Menschen die eigenen Fähigkeiten, Interessen und Einstellungen bewusst macht und diese mit bestimmten Berufen und Berufsrollen in Beziehung setzt. In besonderer Weise werden Entscheidungen über berufliche Bildungswege vom Elternhaus beeinflusst. So weisen etwa junge Menschen aus sozial benachteiligten Familien geringere berufliche Ambitionen auf als Jugendliche aus sozioökonomisch privilegierten Elternhäusern (AGBB, 2024, S. 281). «Der Beruf der Eltern, ihre finanzielle Ausstattung, ihre Bildungsnähe, ein Migrationshintergrund … prägen Bildungs- und Berufslaufbahnen in der Schweiz stark» (Hupka-Brunner, in: Fleischmann, 2024). Die Herkunft beeinflusst den Blick auf die Zukunft!
Knapp die Hälfte der jungen Menschen zwischen 15 und 20 Jahren äussert einen konkreten Berufswunsch (AGBB, 2024, Tab. H2-1web), wobei die Wünsche zumeist geschlechtsspezifisch ausgeprägt sind. Die beruflichen Aspirationen sind zumeist realistisch auf den erworbenen Schulabschluss abgestimmt, d.h. die vorgängige Selektion nach Schultypen schlägt auf die Berufswahl durch. Zudem spielt die regionale Wirtschaftsstruktur mit ihren Berufsoptionen bei der Entwicklung von Berufswahlentscheidungen eine Rolle.
So verlassen ca. zwei Drittel ihren Lehrbetrieb innerhalb des ersten Jahres nach Lehrabschluss und «fünfeinhalb Jahre nach dem Lehrabschluss arbeitet nur noch knapp die Hälfte im ursprünglich erlernten Lehrberuf».
Die skizzierten Befunde deuten darauf hin, dass für einen Teil der jungen Menschen der Berufswahlprozess zu einem (ersten) Ergebnis führt. Doch was geschieht mit dem anderen Teil? Endet die Suche zum Ende der Schulzeit in einer aufgeklärten Ratlosigkeit? Oder werden mit grossem Fleiss faule Kompromisse geschlossen? In der TREE-Studie («Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben») zeigt sich, dass mehr als 20% nach der Schulzeit ein Zwischenjahr einlegt; bei einem Teil wird eine fehlende berufliche Orientierung vermutet (Fleischmann, 2024). Einige Indikatoren zeigen, dass sich die Orientierungsphase bei einem bedeutenden Teil der Jugendlichen auch nach der begonnenen sowie im Anschluss an die Berufslehre fortsetzt. Ein Indikator ist die Zahl der Lehrvertragslösungen. Auch wenn diese viele Ursachen haben können, so zeigen Untersuchungen, dass zu grosse Berufswahlkompromisse das Abbruchrisiko erhöhen (AGBB, 2024, S. 298). Ein weiterer Indikator ist die hohe Zahl von Betriebs- und Berufswechseln im Anschluss an eine Berufslehre. So verlassen ca. zwei Drittel ihren Lehrbetrieb innerhalb des ersten Jahres nach Lehrabschluss und «fünfeinhalb Jahre nach dem Lehrabschluss arbeitet nur noch knapp die Hälfte im ursprünglich erlernten Lehrberuf» (SKBF, 2023, S. 146).
Sind die Erwartungen an die Berufswahlentscheidung von jungen Menschen zu hoch? – Der Zweck heiligt den Optimismus, d.h. das Ziel einer beruflichen Souveränität erscheint erstrebenswert. Es sollte aber nicht mit der Erwartung verbunden werden, dass mit dem Ende der Schulzeit bereits bei den meisten Schulabgängerinnen und -abgängern eine stabile Berufswahlentscheidung getroffen wurde. Vielmehr muss die berufliche Zukunft in dieser Lebensphase weiterhin im Plural gedacht werden können. In diesem Sinne beinhaltet lebenslanges Lernen auch die Option zur beruflichen Neuorientierung.
Die Kolumne von Dieter Euler erschien zuerst in «Folio» des BCH.
Literaturquellen
- AGBB – AGBB – Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024). Bildung in Deutschland 2024. Wbv.
- Aktionsrat Bildung (2023). Bildung und berufliche Souveranität. Waxmann.
- Fleischmann, D. (2024). Der schwierige Weg von der Schule in den Beruf. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 9(2).
- SKBF (2023). Bildungsbericht Schweiz 2023. Aarau: SKBF.
Zitiervorschlag
Euler, D. (2025). Der Zweck heiligt den Optimismus – Berufswahl zwischen Herkunft und Zukunft. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (7).