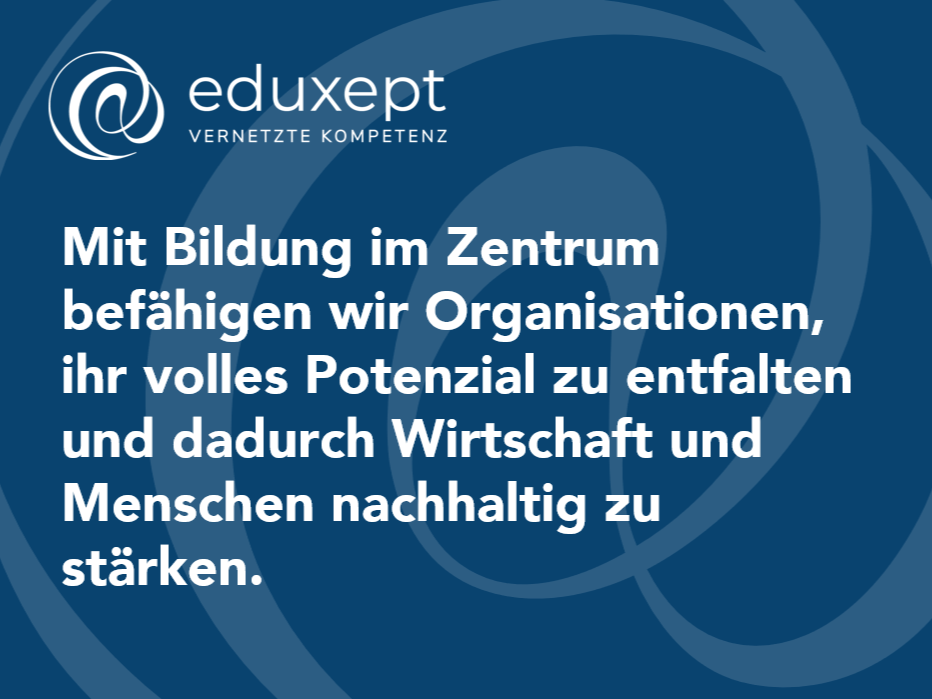Interview mit Daniel Oesch
«Ein Abschluss auf Tertiärstufe ist zur neuen Norm geworden»
Für immer mehr Jugendliche ist die Berufslehre nur ein Zwischenschritt auf dem Weg in eine Hochschule oder in die Höhere Berufsbildung. Aber nimmt die Berufsbildung diese Bedürfnisse wirklich auf? Professor Daniel Oesch sagt, dass ihre Zukunft genau von dieser Frage abhängt. – Das vorliegende Interview ergänzt den Beitrag von Daniel Oesch in der Reihe «Berufsbildung 2040 – Perspektiven und Visionen» mit dem Titel «Die Berufslehre wird zunehmend zum Zwischenschritt zur Tertiärbildung – und das hat Folgen».

Daniel Oesch, Professor für Soziologie an der Universität Lausanne und Direktor des Swiss Centre of Expertise in Life Course Research LIVES.
Daniel Oesch, Sie haben anlässlich der Verbundpartnertagung zur Berufsbildung des SBFI vor einigen Monaten ein Paper zur Attraktivität der Berufsbildung verfasst. Welches war Ihre Hauptthese?
Wir erleben in der Schweiz eine massive Bildungsexpansion. Ein Abschluss auf Tertiärstufe – Hochschule oder Höhere Berufsbildung – ist zur neuen Norm geworden. Vor Ende dieses Jahrzehnts werden mehr Leute mit Tertiärabschluss erwerbstätig sein als ohne. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 hatte weniger als ein Viertel der Schweizer Bevölkerung im Alter von 25-64 eine Ausbildung auf der Tertiärstufe. 2022 waren es fast doppelt so viele: 45%.
Trotzdem sprechen Sie von einer «Tertiarisierungslücke». Was meinen Sie damit?
Die Nachfrage der Unternehmen nach tertiär gebildeten Personen ist noch stärker gestiegen als das Angebot. Wir haben in der Schweiz die paradoxe Situation, dass einerseits viele junge Menschen erfolglos versuchen, eine Hochschulausbildung zu erlangen. Andererseits versuchen viele Arbeitgeber erfolglos, inländisches Personal mit einem tertiären Abschluss zu finden …
… und finden es dann im Ausland.
Genau. Fast zwei Drittel der Erwerbstätigen, die in den letzten zehn Jahren aus der EU in die Schweiz gekommen sind, verfügen über einen solchen Abschluss.
Soll man mehr Leute ins Gymnasium lassen?
Ja, denn offensichtlich bilden wir viel weniger Leute an unseren Hochschulen aus als die Wirtschaft nachfragt. 2024 kamen nur zwei Drittel der neuen Tertiärabschlüsse aus dem Inland, ein Drittel wurde über die Einwanderung abgedeckt. In einzelnen Berufsfelder wie der IT oder Medizin kommt über die Hälfte der jährlichen Abschlüsse aus dem Ausland. Wir legen bei den Gymnasien einen strengen Numerus Clausus fest – und importieren Akademikerinnen und Akademiker aus Deutschland und Frankreich, wo der Zugang zu den Hochschulen offener ist.
Warum beharren einige deutschschweizer Kantone auf tiefen Maturitätsraten?
Aus finanziellen Gründen: Gymnasien und Fachmittelschulen kosten die öffentliche Hand mehr als die Berufsbildung; da ist wenig Anreiz auszubauen. Das unterstützen auch die Arbeitgeber, die befürchten, keine guten Lernenden mehr zu finden, wenn der Zugang zu den Mittelschulen gelockert wird. Schliesslich geistert die Idee herum, dass nur ein kleiner Teil der Jugendlichen für eine Matura und ein Studium bildungsfähig sei. Dieses Argument wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts bemüht. Es hat sich als völliger Unsinn erwiesen.
Wie weit liegt der Tertiarisierungsdruck auch auf der Berufsbildung? Immerhin geht über die Hälfte der tertiären Abschlüsse aufs Konto von Personen, die zuerst eine berufliche Bildung absolviert haben.
Ganz richtig. Nach wie vor absolvieren fast zwei Drittel der Jugendlichen eine Berufslehre. Die Lehre hat als Erstausbildung nur wenig an Bedeutung verloren. Neu ist, dass sie für einen wachsenden Teil der Jugendlichen nur noch einen Zwischenschritt auf dem Weg zur tertiären Bildung darstellt: Universität, Fachhochschule oder Höhere Berufsbildung. Das stellt die Lehre vor neue Herausforderungen. Denn sie muss die Lernenden nicht mehr nur auf einen bestimmten Beruf vorbereiten, sondern auch die Anschlussfähigkeit an weiterführende Bildungsgänge sicherstellen. Die Attraktivität der Berufslehre wird in Zukunft stark davon abhängen, wie gut ihr das gelingt.
Welche Vorschläge machen Sie?
Die Arbeitgeber sagen, sie wollen keine Ausbildung auf Vorrat – aber genau das ist nötig.
Wir sollten erstens die Berufsmatura stärken. Sie ist ein tolles Instrument und hat sich als alternativer Weg an die Hochschulen bewährt. Aber sie wird noch zu wenig genutzt. Das gilt insbesondere für die Berufsmatura während der Lehre (BM1), die nur von 10% der Lernenden absolviert wird – Tendenz abnehmend. Zudem konzentriert die BM1 sich auf wenige Berufe: 75% der Absolvierenden verteilen sich auf nur acht Lehrberufe. Wer eine Berufsmatura machen will, muss dies immer öfter in einem zusätzlichen Jahr nach der Lehre tun (BM2). Das war nicht die Idee der Reform. Wenn die Arbeitgeber schulisch starke Lernende anziehen wollen, müssen sie ihnen die Berufsmatura während der Lehre ermöglichen. In vielen Berufen und Betrieben ist das heute nicht der Fall. Viel wäre bereits gewonnen, wenn die Jugendlichen mehr Zeit für die BM hätten.
Und der zweite Vorschlag?
Es braucht innerhalb der Berufslehre eine Stärkung der Grundkompetenzen, die die Jugendlichen unter anderem befähigen, eine Höhere Berufsbildung in Angriff zu nehmen. Mit drei Lektionen Allgemeinbildung pro Woche erhalten Lernende heute ein zu schwaches Rüstzeug. Ohne solide Kenntnisse in Englisch und Mathematik sind Aus- und Weiterbildungen in vielen Berufen schwierig – von der Kommunikation über Technik und Verwaltung.
Es sind vor allem die Arbeitgeber, die die Berufsbildung steuern, für die Betriebe muss eine Berufslehre rentabel sein. Ist das ein Problem für die Entwicklung des Systems?
Wir haben hier einen typischen Zielkonflikt zwischen betriebs- und volkswirtschaftlicher Logik. Die Arbeitgeber wollen möglichst schulstarke Lernende möglichst viele Stunden im Betrieb haben. Aber das ist nicht unbedingt ideal für die Jugendlichen selber und die Volkswirtschaft. Sie brauchen eine breite Ausbildung für eine unsichere Zukunft. Mechanische Abläufe werden durch elektronische Systeme ersetzt, Textverarbeitung durch Textprogrammierung. Deshalb dürfen wir Berufsfelder und Kompetenzen auch nicht zu eng definieren.
Was sagen die Arbeitgeber zu Ihren Thesen?
Sie sagen, sie wollen «keine Ausbildung auf Vorrat» – aber genau das ist nötig. Man darf den Nutzen einer Lehre nicht nur in der kurzfristigen wirtschaftlichen Verwertung sehen. Heute bildet sich nurmehr eine Hälfte dafür aus, um in den nächsten zehn Jahren den gelernten Beruf auszuüben. Die andere Hälfte ist auf dem Weg zu einem Tertiärabschluss.
Das erwähnte Paper von Daniel Oesch ist in Transfer erschienen: Es findet sich hier. Das vorliegende Interview erschien zuerst ist «Alpha» des Tages-Anzeigers.
Zitiervorschlag
Fleischmann, D. (2025). «Ein Abschluss auf Tertiärstufe ist zur neuen Norm geworden». Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (7).