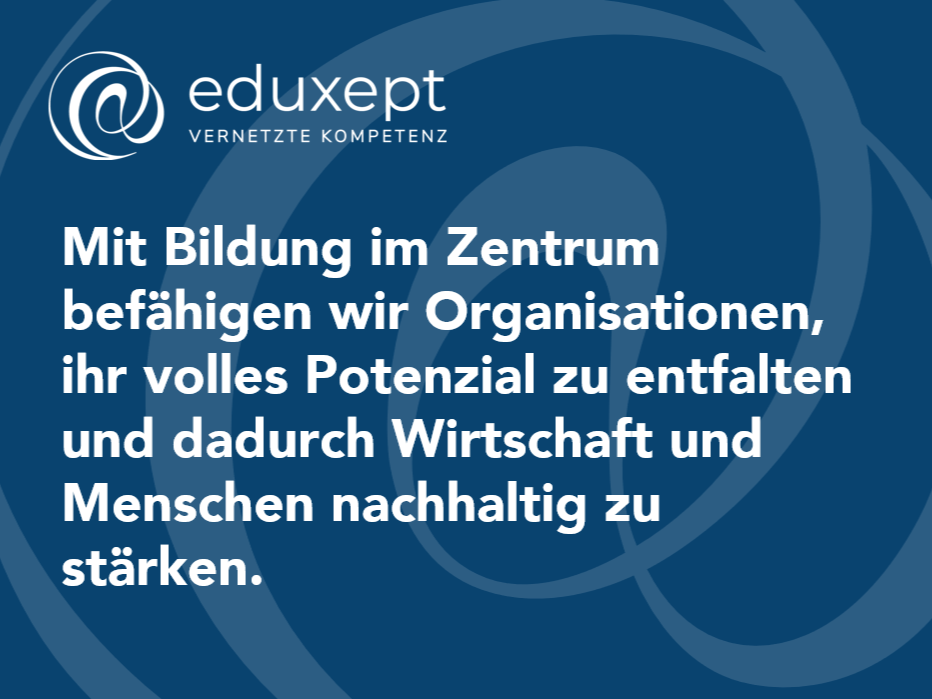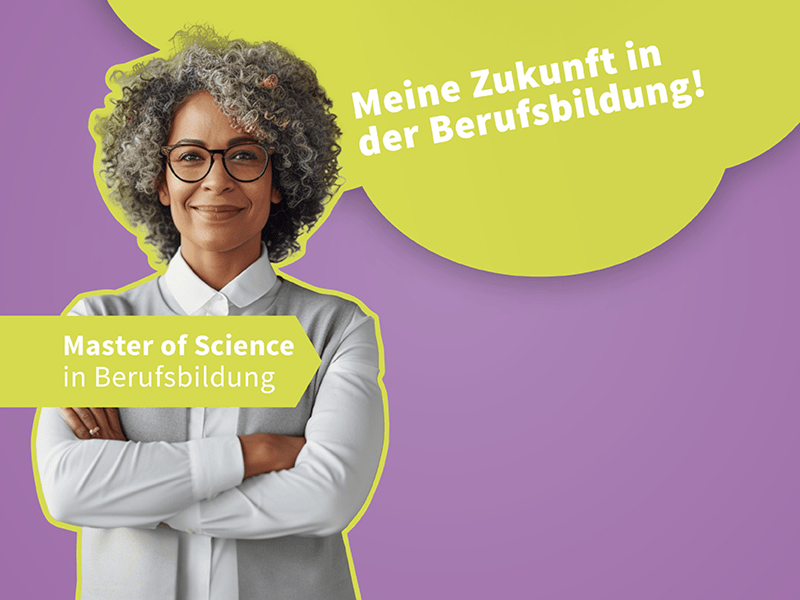Josef Widmer, stv. Direktor SBFI, tritt Ende 2021 zurück
«Wir haben in den letzten Jahren sehr viel erreicht»
Josef Widmer war während 13 Jahren der oberste Berufsbildner der Schweiz. Als stellvertretender Direktor des SBFI hat er wichtige Weichen gestellt, so im Bereich Höhere Berufsbildung, Weiterbildung oder Steuerung der Berufsbildung. Wie gut die Berufsbildung heute dasteht, lässt sich daran ablesen, dass Corona die Zahl der Ausbildungsplätze nicht nachhaltig beschädigte. Im Interview mit Transfer lässt Widmer noch einmal die wichtigsten Schauplätze der Berufsbildung Revue passieren – und äussert sich durchaus kritisch über die Höheren Fachschulen oder das Verhalten der Kantone. Und er teilt mit, wer seine Nachfolge antreten wird.

Josef Widmer: «Natürlich streiten wir immer wieder leidenschaftlich über bestimmte Themen.» Foto: Ruben Hollinger
Interview: Daniel Fleischmann
Josef Widmer, Sie haben vor neun Jahren im SBFI die Stelle als oberster Berufsbildner der Schweiz angetreten. Erinnern Sie sich an Ihre damaligen Erwartungen?
Ja. Ich habe mich darauf gefreut, die Berufs- und Weiterbildung auf nationaler Ebene mitzugestalten, aber auch neue Aufgaben zu übernehmen – die internationalen Kontakte, das Bildungsmonitoring oder die Berufsbildungsforschung. Diese Erwartungen haben sich erfüllt. Noch mehr aber erinnere ich mich an die Erwartungen, die von aussen an mich herangetragen wurden. Damals waren das Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) und das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) frisch fusioniert; ich wurde schon vor Amtsantritt unzählige Male angesprochen, weil die Angst gross war, dass die Berufsbildung unter die Räder kommen könnte. Heute dürfen wir sagen, dass die Fusion gelungen und die Berufsbildung sogar stärker geworden ist.
Sie sprachen von Gestaltungsmöglichkeiten. Wie gut sind sie wirklich in einem so grossen Amt wie dem SBFI?
Sehr gut – zumal das SBFI so gross auch nicht ist. Das Gesetz weist uns viele Möglichkeiten zu, die Berufsbildung zu gestalten. Dem Bund wird explizit die Systemverantwortung übertragen. Systemische Akzente konnten wir etwa bei der finanziellen Förderung der Höheren Berufsbildung setzen oder beim Weiterbildungsgesetz. Beide Dossiers erforderten komplexe Aushandlungsprozesse, die viel Zeit in Anspruch nahmen – typisch für die Berufs- und Weiterbildung.
Wenn Sie unbeschränkte finanzielle Mittel gehabt hätten, hätten Sie mehr gemacht?
Die Kantone (und damit auch der Bund) haben in den letzten Jahren deutlich mehr Mittel in die Förderung des Hochschulsystems gesteckt als in die Berufsbildung.
Nein, die finanziellen Mittel sind durchaus da. Wenn eine Idee überzeugend genug ist, steht die Politik auf Bundesebene hinter der Berufsbildung. In diesem Kontext ist es schwierig zu vermitteln, dass die Berufsbildung trotz dieser guten Voraussetzung in den BFI-Botschaften oft geringere Zuwachsraten aufwies als die Hochschulen. Das hat damit zu tun, dass der Bund seine Ausgaben für die Berufsbildung aufgrund der rechtlichen Grundlagen nur steigern kann, wenn die Kantone es auch tun.
Sie sind nicht zufrieden mit den Kantonen?
Das nicht, die Berufsbildung ist ja nicht unterfinanziert. Aber es ist doch festzuhalten, dass die Kantone (und damit auch der Bund) in den letzten Jahren deutlich mehr Mittel in die Förderung des Hochschulsystems gesteckt haben als in die Berufsbildung.
In der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) lässt sich das Spannungsfeld Bund-Kantone mit Händen greifen. Die Kantone sind zuständig – trotzdem sollen eine nationale Strategie und das Projekt viamia überkantonale Standards etablieren.
Mit der nationalen Strategie versuchen die Kantone selber, ihre teilweise sehr unterschiedlichen Leistungsstandards zu harmonisieren, was wir sehr begrüssen. Mit dem zeitlich befristeten Projekt viamia ist der Bund aktiv geworden, um vor dem Hintergrund der zunehmenden beruflichen Mobilität auf dem Arbeitsmarkt die Beratungsangebote für ältere Arbeitnehmende zu verbessern. Die BSLB bleibt eine Aufgabe der Kantone. Nach Abschluss der Projektfinanzierung müssen die Kantone die etablierten Angebote deshalb in eigener Regie fortführen …
… oder sie wieder fallenlassen. Dann wäre man zurück auf Feld eins.
Ich glaube nicht, dass es soweit kommt. Die Teilnahme der Kantone ist erfreulich, und die ersten Rückmeldungen aus der Bevölkerung sehr positiv. Wichtig finde ich, dass der Flickenteppich, den wir vor Projektstart hatten, mehrheitlich verschwindet; dass am Ende einige wenige Kantone das Angebot nicht gleichermassen weiterführen werden, gehört dazu.
Eines der grossen Projekte im Rahmen der Initiative «Berufsbildung 2030» bildet die Entwicklung von Modellen der Flexibilisierung im Berufsbildungssystem. Wo sollen solche Flexibilisierungen greifen?
Die Grundlage der Flexibilisierungsprojekte bildet die Erkenntnis, dass sich der Arbeitsmarkt und seine Qualifikationsanforderungen enorm schnell entwickeln. Das hat Auswirkungen auf die Inhalte der Berufe und die Steuerung der Berufsbildung. Auf der Ebene der Inhalte müssen wir einerseits dafür sorgen, dass Bildungserlasse rascher und unkomplizierter als heute angepasst werden können. Grosse Reformen wie Kaufleute 2022 werden dann seltener. Auf der anderen Seite brauchen wir Instrumente, die eine Unterscheidung von beruflichen Kernkompetenzen und rasch sich verändernden, spezifischen Kompetenzen ermöglichen sollen. Denkbar ist dann beispielswiese, dass «Frontrunner»-Betriebe neue Inhalte ausprobieren. Oder dass Kompetenzen mehr als heute auf den betrieblichen oder regionalen Bedarf ausgerichtet werden können. Natürlich müssen die vermittelten Fähigkeiten insgesamt vergleichbar bleiben und berufliche Mobilität ermöglichen; das ist ein schmaler Grat. Mehr Flexibilität brauchen wir aber vor allem auch in der Umsetzung – etwa durch eine viel stärkere Individualisierung.
Ist für Sie eine modulare Struktur der Bildungsangebote denkbar?
Nein. Die Idee der Modularisierung mag für die Höhere Berufsbildung und die Weiterbildung geeignet sein, für die berufliche Grundbildung ist sie es eher nicht. Modularisierung macht ja nur Sinn, wenn der Weg zum Abschluss individuell möglichst frei gestaltet werden kann. Das erfordert ein breites Modulangebot, welches in kleineren Berufen oder Kantonen gar nicht möglich wäre. Zudem bleibt das Berufsprinzip ein hohes Gut; junge Leute sollen sorgfältig an ihren Beruf herangeführt werden und brauchen eine emotionale Verbindung zu ihrem Beruf.
Welche Flexibilisierungen sehen Sie auf der Steuerungsebene?
Die Verbundpartner sollten sich gemeinsam Gedanken machen über die künftige Ausgestaltung einer professionellen pädagogischen Begleitung.
Wenn wir Berufe rascher reformieren wollen, müssen wir die Organisationen der Arbeitswelt besser unterstützen. Ich meine das nicht primär finanziell, sondern bezüglich pädagogischem Knowhow. Das Milizsystem stösst an seine Grenzen, viele Verbände sind schon heute überfordert mit den diesbezüglichen Anforderungen und beschäftigen teure Berater. Das ist keine gute Entwicklung. Das Milizsystem ist eine Säule der Berufsbildung. Die Verbundpartner sollten sich deshalb gemeinsam Gedanken machen über die künftige Ausgestaltung einer professionellen pädagogischen Begleitung.
Ein gewichtiges Dossier bildet auch die Höhere Berufsbildung. Welches sind aus Ihrer Sicht aktuelle Erfordernisse?
Das Thema ist vielschichtig. Es ist richtig, dass die Höhere Berufsbildung seit rund 15 Jahren weniger stark gewachsen ist als die Fachhochschulen. Deren Stärkung war jedoch politisch gewollt.
Und: Die Höhere Berufsbildung, die Höheren Fachschulen eingeschlossen, ist kein Sanierungsfall, sie funktioniert gut. Dennoch muss sie gestärkt werden. Einige Schritte dafür sind gemacht: So investieren wir seit 2017 jährlich zweistellige Millionenbeiträge zur Unterstützung von Personen, die sich auf eine eidgenössische Prüfung vorbereiten (2020: rund 60 Mio. Franken). Auf diesem Weg werden wir weitergehen, denn es zeichnet sich ab, dass sich immer mehr Menschen tertiär ausbilden lassen – laut Bundesamt für Statistik sind es in zehn Jahren 55 bis 60 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung. Die Höhere Berufsbildung muss an diesem Wachstum partizipieren, denn der Arbeitsmarkt benötigt nicht nur akademisch gebildete Personen, sondern auch beruflich hochqualifizierte Fachkräfte. Zudem ist die Höhere Berufsbildung für die Attraktivität der gesamten Berufsbildung unabdingbar.
Aus Sicht des SBFI brauchen die drei Ebenen Universität, Fachhochschule und Höhere Berufsbildung klare Profile. An den Universitäten wird Grundlagenforschung betrieben, die Lehre erfüllt wissenschaftliche Ansprüche, der Zugang über die gymnasiale Maturität ist schmal. Die Fachhochschulen erfüllen auch wissenschaftliche Ansprüche, betreiben jedoch angewandte Forschung und der Zugang erfolgt in der Regel über die Berufsmaturität. Die Höhere Berufsbildung schliesslich eröffnet ambitionierten Personen ohne Maturität attraktive Karrieren. Wir sollten diese Profile nicht verwischen. Die jeweiligen Stufen sollten sich über ihre ureigene Identität profilieren.
Vor einem Jahr stellten Sie in Aussicht, die Titelfrage noch einmal zu diskutieren.
Nachdem Deutschland und Österreich Bachelor und Master für Höhere Berufsbildungen eingeführt haben, lag es nahe, noch einmal über das Thema nachzudenken. Die Diskussionen sind in der Verbundpartnerschaft noch im Gange und müssen gemeinsam getroffen werden. Persönlich kann ich mir vorstellen, den Bachelortitel zur besseren internationalen Verständlichkeit in den Diploma Supplements zuzulassen. In der Schweiz bringen die akademischen Titel für Höhere Berufsbildungen hingegen keinen Mehrwert. Ein Professional Bachelor wäre offensichtlich ein Bachelor dritter Klasse und würde kein einziges Problem der Höheren Fachschulen lösen.
Welches sind denn aus Ihrer Sicht diese Probleme?
Die Landschaft der Höheren Fachschulen ist stark zersplittert; es gibt über 200 HF-Anbieter. Knapp die Hälfte davon verzeichnet weniger als 25 Abschlüsse pro Jahr. Das schränkt die Schlagkraft der Höheren Fachschulen ein und behindert die Qualitätsentwicklung. Es gibt Schulen, die pro Jahr weniger als 15 Diplome abgeben – nicht selten sind sie Anhängsel von Berufsfachschulen. Solche Strukturen sind einfach nicht mehr zukunftsfähig.
Versteht man in der Konferenz der Höheren Fachschulen diese Kritik?
Leider nicht. Viele Exponenten sehen nur ihre eigene Schule und blenden bei ihren Forderungen solche Strukturfragen aus. Das SBFI muss jedoch das ganze System im Blick haben.
Dann werden vom Bund auch keine Vorgaben für eine Restrukturierung der Angebotslandschaft erwartet.
Es gibt Schulen, die pro Jahr weniger als 15 Diplome abgeben – nicht selten sind sie Anhängsel von Berufsfachschulen. Solche Strukturen sind einfach nicht mehr zukunftsfähig.
Nein, aber das wäre auch kaum realistisch. Als man die Fachhochschulen etablierte, hatte man ungleich weniger Partner zu überzeugen. Hier aber sind es unzählige Schulen und Verbände, die man nicht einfach in sieben Regionen einteilen kann. Die Entwicklung der Höheren Fachschulen muss organisch erfolgen.
Im Raum steht auch die Forderung der Höheren Fachschulen nach eidgenössisch anerkannten Diplomen.
Diese Forderung ist schwierig zu vereinbaren mit dem Anspruch dieser Schulen, dennoch autonom Prüfungen durchzuführen. Eidgenössisch anerkannte Berufs- und Höhere Fachprüfungen unterliegen der Kontrolle der Verbände und des Bundes; demgegenüber beschränkt sich die Kontrolle der Höheren Fachschulen auf die Rahmenlehrpläne. Auch der Wunsch nach einer institutionellen Anerkennung der Schulen ist angesichts der erwähnten Zersplitterung der Angebotslandschaft illusorisch.
Fachleute kritisieren, dass die Hochschulen die Höhere Berufsbildung oft nicht als gleichberechtigten Partner im tertiären Bildungssystem sehen. Ist das auch Ihr Eindruck?
Das mag es geben, verschwindet jedoch zusehends. Ich kenne viele Hochschulrektoren, die den Wert der Höheren Berufsbildung sehr genau einzuschätzen wissen. Ihnen ist bewusst, was passiert, wenn immer mehr junge Leute in die Hochschulen drängen würden – das lässt sich in vielen anderen Ländern beobachten, deren Delegationen auf der Suche nach besseren Alternativen in die Schweiz reisen. Was sie hier antreffen: Einen schmalen Zugang in die Hochschulen und starke Angebote der Höheren Berufsbildung. Sicher: Der Dialog zwischen den Hochschulen und der Höheren Berufsbildung kann noch gestärkt werden. Aber vielleicht sollten sich vorerst mal die Höheren Fachschulen und die Anbieter höherer Fachprüfungen an einen gemeinsamen Tisch setzen.
Bruno Weber hat eine Eidgenössische Bildungskommission vorgeschlagen, um den Dialog zwischen Hochschulen und Berufsbildung zu stärken.
Ich schätze Bruno Weber sehr, aber dieser Vorschlag führt nicht weiter. Erstens obliegt die Bildungssteuerung einer Vielzahl von Gremien, Behörden und Konferenzen, die sich kaum in einer einzigen Kommission vereinen lassen. Zweitens hätte eine Bildungskommission als ausserparlamentarische Kommission lediglich beratende Funktion und keinerlei Entscheidungskompetenzen. Und drittens haben wir mit Hochschulrat und Swissuniversities einerseits und dem Spitzentreffen Berufsbildung sowie der tripartiten Berufsbildungskonferenz (TBBK) andererseits genügend Organe, die miteinander reden könnten. Hilfreich wäre sicher, wenn man sich innerhalb der Berufsbildung gut abspricht, bevor man auf die Hochschulen zugeht. Mir ist klar, dass die Diversität der Berufsbildung hoch ist. Aber dies schwächt oft die Aussenwahrnehmung.
Die Berufsbildung wird immer wieder auch in einzelnen Pilotprojekten oder Best Practices vorangetrieben. Welche Modelle haben Ihnen besonders Eindruck gemacht?
Berufsbildung lebt in der Tat von der Praxis, und vieles, was an einzelnen Orten oder in einzelnen Branchen ausprobiert wird, taucht später in Bildungsverordnungen oder Rahmenlehrplänen auf. Trotzdem will ich kein Projekt hervorheben, denn wenn ich dies tue, vergesse ich andere, die nicht uninteressanter sind. Ich habe in den letzten Jahren viele Besuche gemacht, in Schulen, Verbänden, Betrieben. Was mich am meisten beeindruckt hat, waren immer wieder Einzelpersonen, die sich unglaublich engagieren und in einem schwierigen Umfeld einen guten Job machen. Sie sind es, die die Berufsbildung voranbringen – die Digitalisierung etwa verdankt ihnen viel. Sie bilden sich weiter, probieren aus und lassen sich auch im Ausland inspirieren. Als Präsident der Stiftung für Austausch und Mobilität (movetia) sehe ich den hohen Wert von internationalen Kontakten. Schweizer Bildungsinstitutionen haben manchmal die Tendenz zu glauben, dass sie besser seien als ihre Partner im Ausland. Dem ist nicht immer so.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass eher wenig ausprobiert wird. Täusche ich mich?
Wir sollten auch wertschätzen, was täglich an wichtiger Grundlagenarbeit geleistet wird; das ist oft ebenso bedeutend wie die Entwicklung von neuen Modellen.
Ich bin mir nicht sicher. Aber warum sind immer nur neue Modelle und spektakuläre Projekte interessant? Ebenso beeindruckend finde ich die Arbeit im Kleinen, bei der Umsetzung bestehender Bildungspläne, bei der Schaffung einer guten Lernkultur in einer Schulklasse, einem guten Umgang mit Lernenden im Betrieb. Wir sollten auch wertschätzen, was täglich an wichtiger Grundlagenarbeit geleistet wird; das ist oft ebenso bedeutend wie die Entwicklung von neuen Modellen. Nehmen wir zum Beispiel die kantonalen Lehraufsichten: Ihre Arbeit ist ebenso unspektakulär wie essenziell. Für die meisten Lehrbetriebe sind sie der direkte Ansprechpartner in der Berufsbildung. Wenn die Lehraufsichten nicht nur administrieren, sondern vor allem auch unterstützen, sich als Partner der Betriebe verstehen und schlanke, effiziente Abläufe anbieten, dann werden sie von den Betrieben respektiert. Ich glaube, dass es auch diese gut funktionierenden Dinge sind, die dazu beigetragen haben, dass die Schweizer Berufsbildung so gut dasteht. Wenn ich nach Deutschland blicke, merke ich, wie wenig selbstverständlich das ist. Wir haben sehr viel erreicht in den letzten Jahren, und die Verbundpartnerschaft steht mit der neuen Governance auf festem Boden. Natürlich streiten wir immer wieder leidenschaftlich über bestimmte Themen. Aber immer auf der Basis der gemeinsamen Überzeugung, dass die Berufsbildung diese Leidenschaft verdient.
Sie waren in den letzten zwei Jahren öffentlich weniger präsent. Weshalb?
Im Sinne einer längerfristigen Nachfolgeplanung habe ich etliche Dossiers sukzessive an Rémy Hübschi übergeben; umgekehrt habe ich teilweise neue Aufgaben (auch ausserhalb der Berufsbildung) übernommen, die weniger öffentlichkeitsrelevant waren.
Dann tritt Rémy Hübschi in Ihre Fussstapfen?
Rémy Hübschi wird die Verantwortung für die Berufsbildung übernehmen. Wer die Stellvertretung der Staatssekretärin übernimmt, ist zurzeit noch nicht bekannt. Mit meinem Weggang ist ausserdem eine Anpassung der Organisation verbunden. Viele meiner Aufgaben werden intern auf mehrere Schultern verteilt.
Sie bleiben dem SBFI im Rahmen von Projekten noch einige Monate treu. Haben Sie weitere berufliche Ambitionen?
Ich bin jetzt 63 Jahre alt, fühle mich fit und habe noch viel Energie. So werde ich noch die eine oder andere Aufgabe übernehmen. Ich präsidiere weiterhin die Stiftung für Austausch und Mobilität (movetia) und ab 2022 auch die Stiftung XUND, die in der Zentralschweiz die Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsfachleuten gewährleistet. Für zukunftsorientierte und interessante Projekte lasse ich mich gerne einspannen. Das Schöne ist, dass ich jetzt auswählen kann, wofür ich mich noch engagiere und wofür nicht. Und ich freue mich, dass ich wieder mehr Zeit haben werde für meine Familie, für meine Freunde und für mich selber.

Josef Widmer im SBFI: Mehr als nur Berufsbildung
Der stellvertretende Direktor des SBFI, Josef Widmer, tritt auf Ende 2021 zurück. Er war seit dem 1. Januar 2013 in dieser Funktion tätig, nachdem er zuvor während 14 Jahren die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern geleitet hatte. Neben den im Interview thematisierten Themen war Josef Widmer auch für eine Reihe weiterer wichtiger Dossiers zuständig, so etwa für die Zusammenarbeit mit der Erziehungsdirektorenkonferenz. Er engagierte sich dabei insbesondere für die Digitalisierung des Bildungswesens, aber auch für das Bildungsmonitoring mit dem alle vier Jahre erscheinenden Bildungsbericht sowie für die gemeinsamen bildungspolitischen Ziele von Bund und Kantonen.