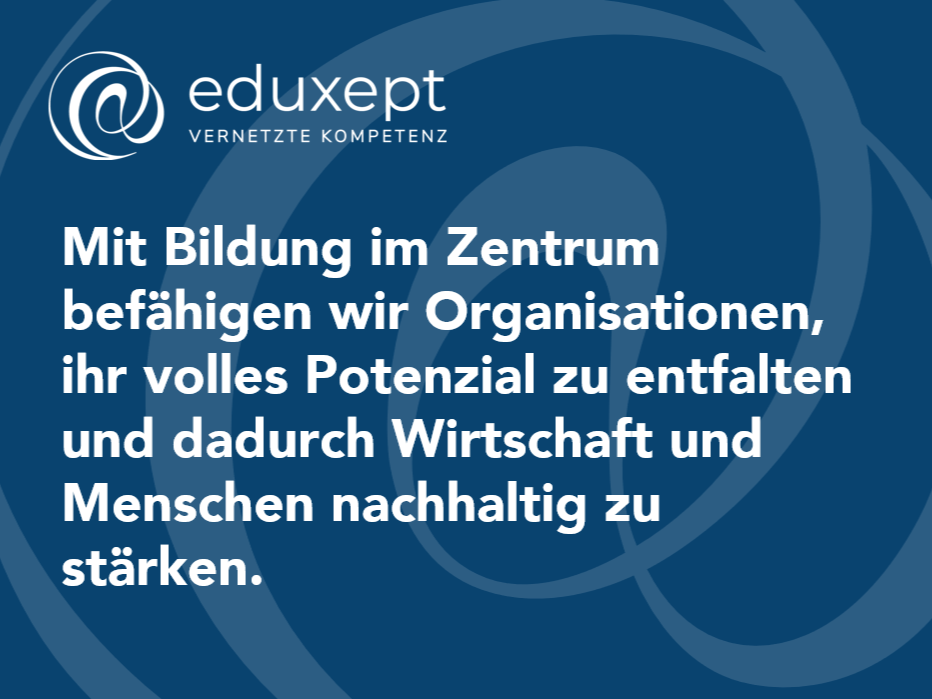Für jede zehnte BM2 in der Schweiz wird Schulgeld bezahlt
Lernende in kostenpflichtigen privaten Berufsbildungen
Weitgehend unbemerkt von der Bildungswissenschaft und -politik absolvieren Lernende ihre berufliche Grundbildung und die Berufsmaturität zunehmend an kostenpflichtigen berufsbildenden Privatschulen. Diese stehen nicht nur in Kontrast zu gängigen Vorstellungen des Schweizer Berufsbildungssystems mit seiner betrieblichen Prägung. Auch scheinen die Schulen – mit Ausnahme der Fachklassen für Gestaltung – insofern Selektionslogiken des Berufsbildungssystems zu umgehen, als dass der Zugang weder über notenbasierte Aufnahmekriterien noch Bewerbungsverfahren geregelt ist. Entscheidend ist einzig, ob das Schulgeld bezahlt werden kann. Basierend auf einer stiftungsfinanzierten qualitativen Studie zeigt der vorliegende Beitrag, welche Lernenden dies vor welchem Hintergrund vermögen.
Berufsbildende Privatschulen in der Schweiz und in internationaler Perspektive
Jede zehnte berufliche Grundbildung im Bereich Kauffrau EFZ und Informatiker EFZ und jede zehnte Berufsmaturität nach der Lehre (BM2) wird an einer Privatschule gegen ein Schulgeld absolviert.
In der Schweiz sind kostenpflichtige private berufliche Bildungen bisher weder Gegenstand der Berufsbildungs- noch der Privatschulforschung (Nikolai, 2019; Preite, 2023). Im Privatschulbereich werden Elitegymnasien und sogenannte International Schools untersucht (Lillie & Delval, 2024). In der Berufsbildungsforschung ist der Blick auf private Akteure auf Betriebe und Unternehmen beschränkt oder es wird die schulisch organisierte Berufsbildung allgemein betrachtet – ohne Unterscheidung zwischen öffentlichen und kostenpflichtigen Angeboten (Ebner & Nikolai, 2010; Esposito, 2024). Diese Forschungslücke erstaunt, zumal aktuell jede zehnte berufliche Grundbildung im Bereich Kauffrau EFZ und Informatiker EFZ sowie jede zehnte Berufsmaturität nach der Lehre (BM2) an einer Privatschule gegen ein Schulgeld absolviert wird (Preite et al. 2025)[1]. Diese Verhältnisse sind vergleichbar mit Quoten an privaten Gymnasien. Dabei ist anzumerken, dass der Markt der Privatschulen – gemessen an den Schulgebühren – den Wert der Berufsbildung rund drei bis viermal geringer einschätzt im Vergleich zu den Gymnasien.
International betrachtet finden sich privatschulische Berufsausbildungen zum Beispiel im Bereich der Further Education im United Kingdom (Simmons, 2010), im Bereich der Technical and Further Education in Australien (Pasura, 2014) sowie als private Berufsfachschulen in Deutschland (Weitz & Ludwig-Mayerhofer, 2024). Während die Privatschulen in Deutschland und der Schweiz eher im Schatten der dualen Berufsbildung stehen, gewinnen profitorientierte private Berufsbildungsanbieter in England und Australien im Kontext neoliberaler (Berufs-)Bildungsreformen an Bedeutung. Hier scheint die Ausgangslage als hybride – das heisst teilsubventionierte – Bildungsinstitutionen ideale Bedingungen für eine «emerging global education industry» (Verger, Steiner-Khamsi, & Lubienski, 2017, S. 325) zu schaffen.
Für berufliche Grundbildung Schulgeld bezahlen
Basierend auf einer von der Avenira Stiftung finanzierten qualitativen Studie[2] konnten im Herbst und Winter 2023/2024 erstmals für den Schweizer Kontext Beweggründe und Ausgangslagen von rund vierzig Lernenden in kostenpflichtigen berufsbildenden Privatschulen erhoben werden. In diesen problemzentrierten Interviews zeigten sich unterschiedliche Muster, warum Lernende für Berufsbildung Schulgeld bezahlen. Gemeinsam ist aber allen interviewten Personen, dass die kostenpflichtige Lösung immer erst «zweite Wahl» war.
Nachdem Perwin mehrere Praktika in Kindertagesstätten absolviert hatte, die ihr alle eine Lehrstelle in Aussicht gestellt hatten, ohne das Versprechen einzulösen, entschied sie sich für eine privatschulische Lösung.
Im Bereich der beruflichen Grundbildung berichten Lernende z.B. davon, wie sie nach Lehrvertragsauflösungen oder verpassten Promotionen in öffentlichen Mittelschulen (Gymnasium, Fachmittelschulen, aber auch Wirtschafts- und Informatikmittelschulen) zu diesen Privatschulen fanden. Ebenso machten Lernende in ihrem Entscheid für eine kostenpflichtige EFZ-Ausbildung Ablehnungserfahrungen auf dem Lehrstellenmarkt sowie Begrenzungen von Ausbildungsmöglichkeiten im öffentlichen und kantonal geregelten Bildungssystem geltend. So versuchte Perwin auf dem Lehrstellenmarkt einen Ausbildungsplatz als Fachfrau Betreuung (FaBe) zu finden. Nachdem sie mehrere Praktika in Kindertagesstätten absolviert hatte, die ihr alle eine Lehrstelle in Aussicht gestellt hatten, ohne das Versprechen einzulösen, entschied sie sich für eine privatschulische Lösung. Die kostenpflichtige Privatschule stellt für Perwin eine Möglichkeit dar, «um irgendwo geschützt zu sein, als Schülerin eigentlich erst mal»; zumal die Schule sie «ja nicht einfach rausschmeissen» kann, weil sie «bezahle» (Interview mit Perwin, 2023).
Nicht zuletzt fanden sich an den Privatschulen auch Lernende, die bereits über eine berufliche Grundbildung verfügen, es aber in Anbetracht berufsbedingter körperlicher Verschleisserscheinungen oder begrenzter Aufstiegsmöglichkeiten vorziehen, sich beruflich umzuorientieren. In dieser Kategorie sind auch Fälle (junger) Erwachsener zu nennen, die wegen berufsbedingter Krankheit oder Unfall über die Invalidenversicherung (IV) eine Zweitausbildung an einer Privatschule absolvieren.
Mittels Schulgeld Aufnahmebedingungen der öffentlichen Berufsmaturität umgehen
Im Bereich der Berufsmaturität nach der Lehre (BM2) berichten Lernende vor allem davon, dass es ihnen über die kostenpflichtigen Privatschulen möglich war, kantonale Aufnahmebedingungen, d.h. eine Aufnahmeprüfung oder einen Mindestnotendurchschnitt im Qualifikationsverfahren, zu umgehen. Den Lernenden ist dabei vollkommen klar, dass ihnen die Bezahlung von Schulgeld einen Bildungszugang eröffnet, der ihnen sonst verschlossen bliebe; oder wie dies Naomi im Interview formuliert: «Der einzige Knackpunkt bei dieser Schule ist, dass es sehr teuer ist. Aber du kannst wirklich prüfungsfrei dorthin […]. Es waren über 10’000 Franken Schulgeld. Einfach weil du prüfungsfrei hingehen darfst.» (Interview mit Naomi, 2023).
Neben dieser Umgehung von Aufnahmebedingungen machen Lernende auch Rahmenbedingungen gelten, die es ihnen an den Privatschulen erlauben, eine verkürzte Teilzeitausbildung zu absolvieren.
Neben dieser Umgehung von Aufnahmebedingungen machen Lernende auch Rahmenbedingungen gelten, die es ihnen an den Privatschulen erlauben, eine verkürzte Teilzeitausbildung zu absolvieren. Im Vergleich zu den öffentlichen Berufsmaturitätsschulen bieten diese Privatschulen auch Ausbildungsgänge an, die in nur einem Jahr mit einem Präsenztag unter der Woche plus einem Präsenztag samstags absolviert werden können. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, parallel zur Ausbildung weiterhin bis zu 80% erwerbstätig zu bleiben. Für Lernende, die das Schulgeld selbst bezahlen müssen, scheint diese Variante unter dem Strich fast «günstiger» zu sein, als wenn sie eine Lohneinbusse wegen reduzierter Erwerbstätigkeit in Kauf nehmen müssten. Umgekehrt wirkt sich dieses Kalkül aber auf die individuelle Lernzeit aus, die den Lernenden für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zur Verfügung steht. So öffnen diese Privatschulen gegen die Bezahlung zwar Ausbildungsmöglichkeiten; die Verantwortung für den Erfolg bleibt aber bei ihnen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund berichten Betroffene mit Sorge, dass sie – angelockt durch Bildungswerbung, in denen hohe Erfolgsquoten propagiert werden – der Doppelbelastung von Ausbildung und Erwerb nur schwer bis kaum gerecht werden. Neben der Befürchtung, die Abschlussprüfung nicht zu bestehen, beschäftigt es sie, dass bei einem Nicht-Bestehen der Prüfung die bezahlten Schulgebühren von 15’000 Franken verloren sind. Einzelne private Anbieter im Bereich der Berufsmaturität sind – oft ohne dass die Lernenden dies wissen – keine kantonal akkreditierten Privatschulen, sondern lediglich Dienstleister, die Vorbereitungskurse zur eidgenössischen Berufsmaturitätsprüfung anbieten.
Berufsbildung gegen Bezahlung? – Eine Einordung
Kostenpflichtige berufsbildende Privatschulen sind nicht erst seit gestern Teil des Schweizer Berufsbildungssystems.
Kostenpflichtige berufsbildende Privatschulen sind nicht erst seit gestern Teil des Schweizer Berufsbildungssystems. Historisch gewachsen finden sich diese Schulen z.B. im Bereich der Handels-, Informatik- und Gesundheitsmittelschulen, aber auch im Bereich der Fachklassen für Gestaltung oder auch der Ausbildungen im Bereich der Körperpflege (Coiffeur sowie Kosmetikerin). Mit Blick auf aktuelle Entwicklungen stellt sich allerdings die Frage, ob die Privatschulen kurz- und mittelfristig ins Visier multinationaler, profitorientierter Bildungsunternehmen geraten. Die im Rahmen der qualitativen Studie ebenfalls befragten Schul- und Abteilungsleitungen dieser Privatschulen berichteten zum Teil offen darüber, welche Umsätze und Gewinnmargen sie erwirtschaften. Es lässt sich beobachten, dass einzelne Privatschulen auch in multinationale Bildungsunternehmen integriert (d.h. gekauft) werden, an denen private-equity-fonds beteiligt sind.
In Anbetracht der nach wie vor nicht erreichten Sek-II-Quote von 95% stellt sich schliesslich die Frage, ob das selektive öffentliche Bildungs- und das betrieblich organisierte Berufsbildungssystem die zu erwartende demographisch bedingte Zunahme von Schulabgängerinnen absorbieren kann oder ob sich zusätzliche Wachstumsmärkte für Privatschulen auf der Sekundarstufe II entwickeln. Letztlich kann es diesen Privatschulen egal sein, wie und warum Jugendliche und junge Erwachsene keinen Zugang zur Berufsbildung und Berufsmaturität finden; d.h. ob es an (elterlichen) Präferenzen für eine schulische statt betriebliche Ausbildung liegt (vgl. Abrassart, Busemeyer, Cattaneo, & Wolter, 2020; Jaik & Wolter, 2019), realen Erfahrungen von Ablehnung auf dem Lehrstellenmarkt oder kantonal ungleichen Zugangsregelungen zur Berufsmaturität (vgl. Hänni, Kriesi, & Neumann, 2022; Imdorf, 2017; Meyer & Sacchi, 2020). Gegen die Bezahlung von Schulgeld, das (wie gesagt) rund drei bis viermal günstiger als in privaten Gymnasien ist, öffnen diese Privatschulen uneingeschränkt Zugang zu einer Berufsbildung (teilweise mit Fachhochschulreife) – einer Ausbildung, die zusehends zur Mindestnorm erhoben wird, ohne aber öffentlich garantiert zu sein.
Vor diesem Hintergrund ist es insbesondere für die angewandte Berufsbildungsforschung relevant, die Privatschulen mitzuberücksichtigen. Dabei ist noch genauer zwischen den Bereichen berufliche Grundbildung und Berufsmaturität zu unterscheiden. Im Rahmen der beruflichen Grundbildung weisen einzelne Privatschulen eine zum Teil auch langjährige Tradition auf und übernehmen dabei – gegen Bezahlung von Schulgeld – in gewisser Hinsicht auch kompensatorische Funktionen in einer betrieblich dominierten Berufsbildung. Demgegenüber scheinen sich im Bereich der Berufsmaturitätsschulen zum Teil auch losgelöst von kantonalen Regulierungen reine Dienstleister zu entwickeln, die mit uneingelösten Bildungsaspirationen von Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen Profit erzielen.
[1] Für eine detaillierte Darstellung der quantitativen Entwicklung von Lernenden an berufsbildenden Privatschulen differenziert nach Wohnkanton vergleiche Preite (2023). Vorausgreifend lässt sich dazu sagen, dass diese Privatschulen bis anhin Lehrgänge im Bereich des Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) sowie der Berufsmaturität (BM2), nicht aber der Eidgenössischen Berufsattestausbildung (EBA) anbieten. Bezogen auf das Schulgeld sind gestalterische Ausbildungen am teuersten (z.B. 70’000 CHF für Grafikerin EFZ und Fotograf EFZ:), gefolgt von Informatikerin EFZ (50’000 CHF), während Kaufmann EFZ und Medizinische Praxisassistentin EFZ sowie aktuell nicht mehr angebotene Lehrgänge im Bereich Fachmann Betreuung EFZ mit Schwerpunkt Kleinkindererzieherin rund 30’000 bis 40’000 CHF kosten. Das Phänomen einer kostenpflichtigen privatschulischen beruflichen Grundbildung scheint dabei regional betrachtet vor allem in der Nordostschweiz ausgeprägt zu sein, während es im Bereich der Berufsmaturität mehrheitlich die ganze Deutschschweiz betrifft. Im Vergleich dazu sind berufsbildende Privatschulen in der Romandie und dem Tessin geringer, während in Genf und der Waadt allgemeinbildende Privatschulen zahlreich sind. [2] Im Forschungsprojekt «Berufsbildung gegen Bezahlung: Lernende in kostenpflichtigen Berufsausbildungen» haben Jasmin Imboden, Simona Gmür, Evelyn Fischer und Nayeli Pfister als wissenschaftliche Assistenzen und studentische Hilfskräfte mitgearbeitet. Die Datenerhebung- und Auswertungsphase dauerte von September 2023 bis August 2024. Dabei wurden vierundvierzig Lernenden sowie sieben Schulleitungen an sechs Privatschulen in der deutschsprachigen Schweiz interviewt (vgl. Preite et al 2025).Literatur
- Abrassart, A., Busemeyer, M. R., Cattaneo, M. A., & Wolter, S. C. (2020). Do adult foreign residents prefer academic to vocational education? Evidence from a survey of public opinion in Switzerland. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(15), 3314-3334.
- Büchter, K. (2021). Vollzeitschulische Ausbildung – Historische (Dis-)Kontinuität ihrer Strukturmerkmale und Funktionen. In L. Bellmann, K. Büchter, I. Frank, E. M. Krekel, & G. Walden (Eds.), Schlüsselthemen der beruflichen Bildung in Deutschland: ein historischer Überblick zu wichtigen Debatten und zentralen Forschungsfeldern (S. S. 141-154). Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.
- Ebner, C., & Nikolai, R. (2010). Duale oder schulische Berufsausbildung? : Entwicklungen und Weichenstellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Swiss political science review : SPSR, 16(H. 4), S. 617-648.
- Esposito, R. S. (2024). Vocational Middle Schools (VMSs) as Marginalized Part of the Swiss VET System. A Governance Perspective on Functions, Steering Instruments, Justifications and Sacrifices, 1(1), 11-32.
- Hänni, M., Kriesi, I., & Neumann, J. (2022). Entry into and Completion of Vocational Baccalaureate School in Switzerland: Do Differences in Regional Admission Regulations Matter? Education Sciences, 12(3).
- Imdorf, C. (2017). Understanding discrimination in hiring apprentices: how training companies use ethnicity to avoid organisational trouble. Journal of Vocational Education & Training, 69(3), 405-423.
- Jaik, K., & Wolter, S. C. (2019). From dreams to reality: market forces and changes from occupational intention to occupational choice. Journal of Education and Work, 32(4), 320-334.
- Lillie, K., & Delval, A.-S. (2024). Switzerland as a Site of Capital Accumulation: The Case of International Education. Swiss Journal of Sociology, 50(2), 127-142.
- Meyer, T., & Sacchi, S. (2020). Wieviel Schule braucht die Berufsbildung? Eintrittsdeterminanten und Wirkungen von Berufslehren mit geringem schulischen Anteil. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 72(1), 105-134.
- Nikolai, R. (2019). Staatliche Subventionen für Privatschulen: Politiken der Privatschulfinanzierung in Australien und der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 41(3), 559-575.
- Pasura, R. (2014). Neoliberal economic markets in vocational education and training: shifts in perceptions and practices in private vocational education and training in Melbourne, Australia. Globalisation, Societies and Education, 12(4), 564-582.
- Preite, L. (2023). Berufsbildung gegen Bezahlung. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 8(2).
- Preite, L.; Gmür, S.; Imboden, J.; Fischer, E. & Nayeli, P. (2025). Berufsbildung gegen Bezahlung. Beweggründe und Ausgangslagen von Lernenden in der kostenpflichtigen privatschulisch organisierten beruflichen Grundbildung und Berufsmaturität. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 47(1). S. 44-56.
- Simmons, R. (2010). Globalisation, neo‐liberalism and vocational learning: the case of English further education colleges. Research in Post-Compulsory Education, 15(4), 363-376.
- Verger, A., Steiner-Khamsi, G., & Lubienski, C. (2017). The emerging global education industry: analysing market-making in education through market sociology. Globalisation, Societies and Education, 15(3), 325-340.
- Weitz, J., & Ludwig-Mayerhofer, W. (2024). Duale und schulische Berufsausbildungen in Deutschland: Schritte zu einem umfassenden Verständnis von beruflicher Bildung. Berliner Journal für Soziologie, 34(3), 339-375.
- Wettstein, E., & Amos, J. (2010). Schulisch organisierte berufliche Grundbildung. Eine Studie im Auftrag des SBBK.
Zitiervorschlag
Preite, L. (2025). Lernende in kostenpflichtigen privaten Berufsbildungen. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (7).