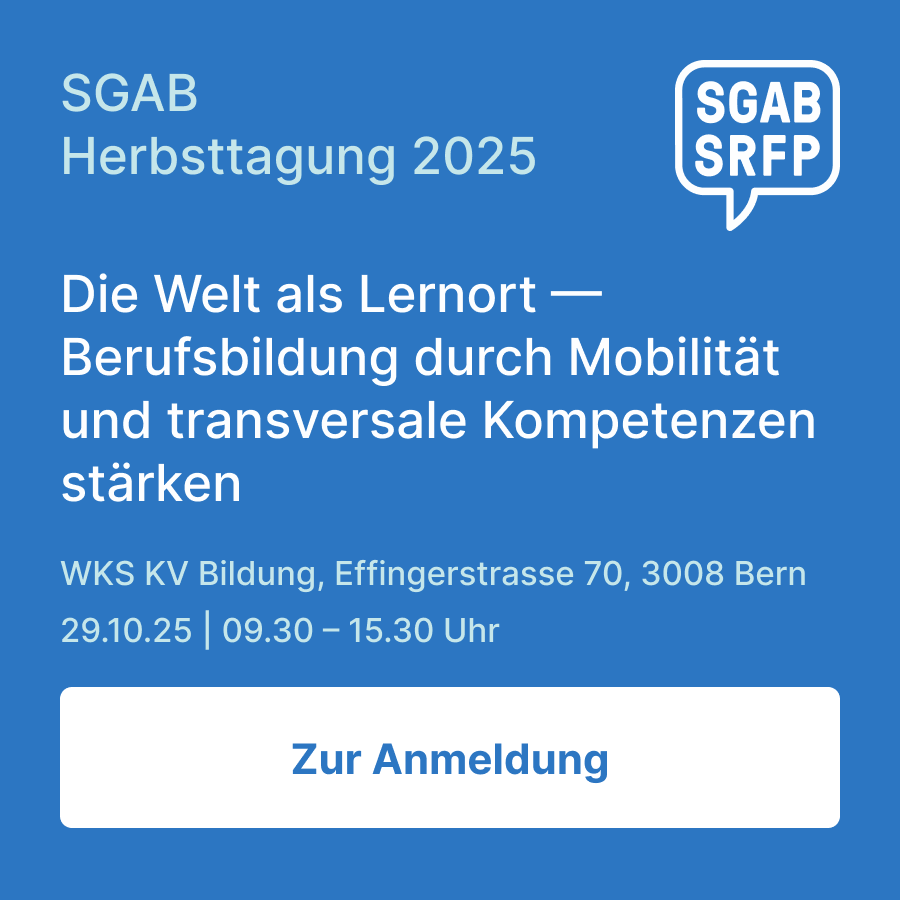Andreas Pfister über sein neues Buch im hep Verlag: «Neue Schweizer Bildung»
«Wir bilden die Jugendlichen zu wenig»
Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er Angst vor Konfrontationen hätte: Andreas Pfister, Gymnasiallehrer und Buchautor. Schon vor vier Jahren forderte er die «Matura für alle», jetzt unterfüttert er das Postulat in einem neuen Buch mit zusätzlichem Material. Was treibt Pfister um? Der Arbeitsmarkt brauche mehr Akademikerinnen und Akademiker, antwortet er. Und von Bildungsgerechtigkeit seien wir noch immer weit entfernt.

Andreas Pfister: «Nein, ich sehe nicht, dass die Berufsbildung mich ernst nehmen würde.» Photo | Daniel Fleischmann
Andreas Pfister, wo sehen Sie den zentralen Mangel des heutigen nachobligatorischen Bildungssystems?
Das nachobligatorische Bildungssystem hält nicht Schritt mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. 2021 waren 43 Prozent der Erwerbstätigen tertiär gebildet; das ist in der Summe zu wenig, besonders aber im Bereich der Personen mit einer universitären Bildung. Die akademische Spitze der Bildungspyramide ist viel zu schmal. Das bestätigt zum Beispiel BAK Economics im jüngst erschienenen Bericht «Schweiz 2035». Die Beratungsfirma spricht von Risiken, die die Position der Schweiz als innovatives Land bedrohten; dazu zählt sie die «im internationalen Vergleich geringere Zahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen (insbesondere in den Naturwissenschaften).» Auch Forschungen des Seco oder des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich machen solche Aussagen.
Können Sie das präzisieren?
Das Seco hat 2016 die Publikation «Fachkräftemangel in der Schweiz» veröffentlicht. Diese enthält einen «Gesamtindex Fachkräftemangel», in dem zuoberst auffällig viele Tätigkeiten rangieren, die eine tertiäre Bildung voraussetzen: Ingenieurberufe, Techniker, Managementberufe, Rechtswesen, Gesundheitsberufe und Informatikberufe. Natürlich ist diese Liste unscharf, weil sie – das Beispiel der Gesundheitsberufe – verschiedene Qualifikationsniveaus vermischt. Aber die Hauptaussage wird durch das Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit bestätigt. Die Studie «Berufe mit hohem Fachkräftemangel» von 2016 zeigt, dass vier der fünf Berufe mit dem höchsten Fachkräftemangel akademische Berufe sind: Ärzte, Ingenieurinnen, Softwareentwickler und -analytiker sowie Sonstige akademische Gesundheitsberufe. Von den 15 untersuchten Berufen ohne Fachkräftemangel ist nur einer über ein Studium zu erreichen: Bibliotheks- und Museumswissenschaftler.
Sie sagen, die wirtschaftliche Entwicklung akzentuiere die Nachfrage nach hochschulisch gebildeten Personen. Sprechen Sie von Prozessen wie Robotisierung und Digitalisierung?
Ich nenne das im Untertitel meines Buches «Moderne 4.0», ja. Allerdings verblassen die Etiketten allmählich, der Prozess der Digitalisierung ist als Prozess ja fast schon Vergangenheit, so dass man von Digitalität sprechen könnte.
Darauf wollte ich hinaus: Die Wirtschaft wird schon seit Jahrzehnten automatisiert und digitalisiert – und die Bildung hat gut Schritt gehalten. 2011 besassen erst 32% der Erwerbstätigen eine tertiäre Bildung, zehn Jahre später waren es, Sie nannten die Zahl, 43%. Das ist ein respektables Tempo!
Ich möchte in keiner Weise die Leistungsfähigkeit des berufsbildenden Systems in Abrede stellen: Sie orientiert sich dynamisch an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts und sorgt für eine hohe Arbeitsmarktintegration.
Ich möchte in keiner Weise die Leistungsfähigkeit des berufsbildenden Systems in Abrede stellen: Sie orientiert sich dynamisch an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts und sorgt für eine hohe Arbeitsmarktintegration. Trotzdem ist das Tempo zu langsam. Zudem stelle ich fest, dass sich die von Ihnen beschriebene Steigerung in einem hohen Mass dem Zuzug von ausländischen Fachleuten verdankt. Philippe Wanner und Ilka Steiner (Universität Genf)etwa sprechen von einem «spektakulären Anstieg der hochqualifizierten Zuwanderung in die Schweiz»: Diese habe sich zwischen 1991 und 2014 mehr als verdoppelt und erkläre sich «hauptsächlich durch die Arbeitskräftenachfrage, die durch die neuen Generationen der ins Erwerbsleben eintretenden einheimischen Arbeitskräfte nicht befriedigt werden konnte». Eine andere Zahl: Der Anteil der «Bildungsausländer» unter den Universitäts-Studierenden betrug 1990/91 13%, im Jahr 2020/21 mehr als das Doppelte.
Im Ausland gut qualifizierte Leute sind nun mal Akademiker, weil man hier die Höhere Berufsbildung kaum kennt. Die Crux ist doch, dass gängige Begriffe wie Upskilling, Hochqualifizerte oder Tertiarisierung ungenau sind. Selbst die von Ihnen genannten Untersuchungen unterscheiden nicht zwischen hochschulischer Bildung (Tertiär A) und Höherer Berufsbildung (Tertiär B). Wenn man aber bei Branchenverbänden wie Swissmem oder Autogewerbeverband nach ihrem Qualifikationsbedarf fragt, sind die Auskünfte klarer: Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, aber kaum zusätzliche Akademiker, sagen sie.
Diese Verbände bestimmen die Nachfrage nicht allein. Die «Moderne 4.0», von der ich spreche, umfasst die Gesellschaft als Ganzes, beispielsweise auch die Nachfrage im öffentlichen Sektor. Ich habe im Rahmen meiner Recherchen ebenfalls mit einer Reihe von Verbänden gesprochen. Mein Eindruck: Niemand weiss präzise genug, welche Qualifikationsniveaus die Industrie, der Handel oder das Dienstleistungsgewerbe brauchen. Dass Teile der Wirtschaft ihren Bedarf an Akademikerinnen und Akademikern selbst nicht kennen, sollte uns zu denken geben. Noch stossender aber finde ich, dass im bildungspolitischen Diskurs es trotzdem niemand mehr wagt, eine höhere Akademikerquote zu fordern. Das Gelände ist völlig vermint, seit die Akademien der Wissenschaften 2009 mit ihrem Weissbuch «Zukunft Bildung Schweiz» die Berufsbildung in Frage stellte. Wenn Sie auf der Website des Arbeitgeberverbandes nach bildungspolitischen Forderungen suchen, ist ausschliesslich von der Berufsbildung die Rede. Für die Hochschulen sei economiesuisse zuständig, heisst es auf Nachfrage. Aber auch hier wird zunächst nur von dualer Bildung gesprochen.
Das Bildungssystem verletze auch die Chancengerechtigkeit, schreiben Sie. Warum?
Die theoretisch gegebene Durchlässigkeit des Bildungssystems ist faktisch nicht erreicht.
Die theoretisch gegebene Durchlässigkeit des Bildungssystems ist faktisch nicht erreicht. Es sind viel zu wenige Jugendliche, die die Durchgänge zwischen den Bildungsstufen tatsächlich nutzen. Die Passerelle – ein Weg, der schon begrifflich schmal angelegt ist – zwischen der Berufs- oder Fachmaturität und einem hochschulischen Studium nutzten 2020/21 kaum 2000 Jugendliche. Auffällig ist auch, dass sich die BM-Absolvierenden nur auf wenige Berufe konzentrieren. Drei Viertel verteilen sich nur auf acht EFZ-Berufe: Elektronikerin, Laborant, Konstrukteurin, Mediamatiker, Zeichnerin, Informatiker, Automatikerin und Kaufmann. Was ist mit den anderen Berufen? Die Berufsmaturität steckt in einer Krise, viele Bildungsbetriebe verweigern ihren Lernenden die Teilnahme. Sie tun es, weil die Ausbildung von Lernenden Teil des Geschäftsmodells ist: Sie sind auf den ökonomischen Nutzen der Lernenden angewiesen. Das ist nicht böse, sondern eine Realität, der man Rechnung tragen sollte.
Sie sprechen – nicht nur an dieser Stelle – die Höhere Berufsbildung kaum an und unterschlagen, dass sich auch Lernende ohne Maturität weiterqualifizieren können.
Sie haben recht: Die Höhere Berufsbildung eröffnet attraktive Laufbahnperspektiven; sie verspricht teilweise gar höhere Löhne als hochschulische Bildungsgänge. Trotzdem glaube ich, dass die Berufsmaturität mit ihrer stärkeren Gewichtung der schulischen Bildung der richtige Weg ist. Es braucht eine Berufsmaturitäts-Pflicht. Es wird viel von Eigenverantwortung gesprochen; ich unterrichte Jugendliche in diesem Alter und bin überzeugt, dass sie ihr zu wenig gewachsen sind. Sie brauchen mehr Unterstützung.
Sie wollen die Jugendlichen in die tertiäre Bildung schubsen?
Wenn Sie so wollen, ja. Als die Volksschule etabliert wurde, überliess man die Teilnahme auch nicht den Eltern oder den Kindern, sondern erhob den Schulbesuch zur Pflicht. Nur so lässt sich Chancengerechtigkeit tatsächlich etablieren. Bildungsbiografien sind in der Schweiz immer noch weniger von Leistungsmerkmalen bestimmt als von Merkmalen der sozialen Herkunft. Die TREE-Studien zeigen das eindrücklich. So hat die soziale Herkunft auch unter Kontrolle der Schulleistungen einen bedeutenden Einfluss auf die Zuteilung zu den einzelnen Schultypen, die wiederum in hohem Masse vorstrukturiert, in welche nachobligatorischen Ausbildungsgänge Schülerinnen und Schüler münden. Wie stark die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem der Schweiz beschädigt ist, zeigt auch ein Blick auf die kantonalen Maturaquoten: Im Kanton Genf erlangt jeder dritte Jugendliche eine gymnasiale Maturität, im Kanton Glarus jeder achte. Die Differenzen sind auch ohne Röstigraben eklatant. Solche Zusammenhänge müssen wir mit einer Maturitätspflicht durchbrechen; es reicht nicht, nur für eine höhere Beteiligung an der Berufsmaturität zu werben, wie es im Rahmen von Berufsbildung 2030 passiert.
In Ihrem Buch verwenden Sie auch den Begriff der humanistischen Bildung. Glauben Sie, dass es Lernenden in der Berufsbildung daran mangelt?
Ja. Lernende in der Berufsbildung haben, finde ich, nicht nur einen Anspruch auf Ausbildung, sondern auch auf Bildung. Repetitive Tätigkeiten nehmen ab, während der Bedarf an eigeninitiativen Menschen wächst. Reflexion, Methodenkompetenzen, Dialogfähigkeit – solche intellektuellen Kompetenzen werden immer mehr gefragt sein. Denken ist eine Praxis, die man üben muss.
Das ist auch in der Berufsbildung geläufig; auch hier sieht man die hohe Notwendigkeit der Förderung von überfachlichen Kompetenzen. Aber was Sie fordern, hat ja vor allem eine inhaltliche Dimension: Weg von den fachlichen Lerngegenständen hin zu einer humanistischen Menschenbildung etwa über die Auseinandersetzung mit Werken der Literatur.
Ich bin der Meinung, dass Bildung nicht nur an ihrem ökonomischen Nutzen gemessen werden darf. Es geht auch um Dinge wie politische Beteiligung, gesellschaftliche Teilhabe, Fragen der eigenen Lebensführung (Gesundheit, Familie) oder ökologische Themen.
Zum einen glaube ich, dass auch solche Gegenstände vom Menschen in beruflichen Kontexten verwertet werden können, auch wenn sich das nicht planen lässt. Zum anderen bin ich der Meinung, dass Bildung nicht nur an ihrem ökonomischen Nutzen gemessen werden darf. Es geht auch um Dinge wie politische Beteiligung, gesellschaftliche Teilhabe, Fragen der eigenen Lebensführung (Gesundheit, Familie) oder ökologische Themen. Das sieht man ja auch in der Berufsbildung so, wo es den allgemeinbildenden Unterricht (ABU) gibt. Aber das Fach hat einen schweren Stand, seine Verfechter wünschen seit Jahren vergeblich, dass man es besser ausstattet.
Sie fordern eine Maturität für alle. Welche Effekte erwarten Sie auf die Teilnahme an höheren Bildungen?
Wenn man den schulischen Rucksack der Lernenden in der Sekundarstufe II besser füllt, werden mehr Jugendliche an eine Hochschule oder in eine Höhere Berufsbildung übertreten, das zeigen die Zahlen schon heute. Quoten aber kann ich keine nennen.
Ein Effekt könnte sein, dass die Höhere Berufsbildung Schaden nimmt, wenn alle Lernenden dank der Maturität Zugang zu den Hochschulen haben. Wie wollen Sie das verhindern?
Diese Frage stellt sich mir nicht. Es darf, wenn wir die Ausbildung der kommenden Generationen konzipieren wollen, keinen Heimatschutz für bestehende Bildungsangebote geben. Wenn die Jugendlichen statt eine Höhere Berufsbildung ein Hochschulstudium wählen – auch gut! Denn wir brauchen nicht nur mehr gut qualifizierte Leute für den Arbeitsmarkt, auch der Forschungsstandort Schweiz muss gestärkt werden.
Maturitätslehrgänge stellen hohe Ansprüche. Wie lässt sich sicherstellen, dass nicht unzählige junge Leute die Ausbildung abbrechen, weil das Niveau zu hoch ist?
Ich glaube, solche Abbrüche wird es nicht geben. Letztlich ist es eine Frage der Haltung, dafür zu sorgen, dass die Lernenden die Schule, die sie besuchen, erfolgreich abschliessen können. Ich glaube an die Jugendlichen und daran, dass sie das können, und ich glaube an die Kraft der Pädagogik. Warum? Weil ich sehe, dass man in unterschiedlichen Kontexten immer wieder von einem drohenden Niveauverlust sprach, der dann doch nicht eintrat. In den 50er-Jahren betrug die Anzahl Jugendlicher, die eine Berufslehre machten, nur ein Viertel. Gross war die Sorge ums Niveau, als man die Berufslehre zum flächendeckenden Standard machte. Kompetenzen entstehen, in dem man sie bildet. Unsere Jugendlichen sind intellektuell nicht am Anschlag, aber wir bilden sie zu wenig. Ich fordere, dass man aufhört, Hochqualifizerte ins Land zu holen; stattdessen soll man endlich die eigene Jugend an der Entwicklung des Landes teilhaben lassen.
Damit die allermeisten Lernenden die Maturität erreichen, wird man das Niveau senken müssen.
Hinter dieser Prognose erkenne ich eine Skepsis gegenüber der schulischen Bildungskultur und ihren Möglichkeiten; diese Skepsis ist in der Schweiz besonders ausgeprägt. Aber damit bremst man die eigene Jugend aus. Trotzdem verstehe ich Ihre Befürchtung ein Stück weit. Ich schlage darum vor, die Berufsmaturität nach dem Vorbild der Sekundarstufe I in zwei Leistungsniveaus aufzuteilen und den Möglichkeiten von schwächeren Lernenden Rechnung zu tragen. Von der Maturitätspflicht ausgenommen sind zudem Lernende in einer zweijährigen Grundbildung. Denkbar ist, dass durch die Erhöhung der schulischen Anforderungen die Zahl der Lernenden in einer Attestbildung etwas steigt.
Genau diese Differenzierung besitzt das Bildungssystem doch bereits: Hochschulische Bildungswege für die Inhaberinnen einer Maturität und – dank der Höheren Berufsbildung – intakte Laufbahnperspektiven für Jugendliche, die auf Schule zunächst wenig Lust haben. Ihre Vorschläge gefährden dieses bewährte System, das sich zudem laufend weiterentwickelt. So bemüht sich die Bildungspolitik um eine Steigerung der BM-Quoten.
Sie tut es ohne Erfolg. Zugleich sind die gymnasialen Maturitätsquoten praktisch eingefroren, und die Teilnahme an universitären Bildungen ging zwischenzeitlich sogar leicht zurück. Wie auch immer: Mir geht es um einen Ausbau der schulischen Bildung – auf allen Ebenen.
Der Vorschlag, die Allgemeinbildung zu stärken, führt zu einer Verminderung der berufskundlichen Bildung. Wie wollen Sie die Betriebe von diesem Downskilling überzeugen?
Letztlich bin ich aber gar nicht so sicher, wie viele Betriebe es tatsächlich sind, die Schwierigkeiten bekommen und auszubilden aufhören, wenn ihre Lernenden einen halben oder ganzen Tag zusätzlich in der Schule sind.
Das ist eine schwierige Frage, für die ich keine einfache Lösung habe. Aber ist der Status Quo denn besser, in dem man den Jugendlichen Bildung vorenthält? Was klar ist: Die ökonomische Situation der ausbildenden Betriebe muss man ernst nehmen. Ich schlage darum ein Lehrgeld vor, das die Rentabilitätseinbussen kompensiert, die durch die längere Abwesenheit der Lernenden entsteht. Eine solche finanzielle Entlastung hat man ja auch mit der subjektorientierten Finanzierung in der Höheren Berufsbildung eingerichtet. Letztlich bin ich aber gar nicht so sicher, wie viele Betriebe es tatsächlich sind, die Schwierigkeiten bekommen und auszubilden aufhören, wenn ihre Lernenden einen halben oder ganzen Tag zusätzlich in der Schule sind. In Deutschland sieht man, dass selbst dann Lernende ausgebildet werden, wenn die Ausbildung selber nicht rentiert. Die Betriebe stellen auch in Rechnung, dass sie, indem sie eigenen Nachwuchs ausbilden, die schwierige Rekrutierung von Arbeitskräften vermeiden.
Ihre Vorschläge sind einschneidend. Sehen Sie, dass Sie von Exponentinnen der Berufsbildung ernst genommen werden?
Nein, das sehe ich nicht. Man schüttelt den Kopf und stellt fest, dass ich aus dem akademischen Milieu käme. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die Hochschulen die Berufsbildung auch lange nicht genügend ernst nahmen. Diese mangelnde Gesprächskultur sollte man aufbrechen. Darum schlage ich vor, die Governance neu zu gestalten, wie es in der gegenwärtigen Reform der Gymnasiums teilweise geschieht. Es braucht eine übergeordnete Struktur, in der man die Frage nach der richtigen Bildung für die Moderne 4.0 unvoreingenommen und ohne Eigeninteressen diskutiert. Die Berufsbildung hat in den letzten Jahrzehnten enorm an Prestige gewonnen; das ist eine grosse Leistung. Aber der Diskurs ist nun ins Gegenteil gekippt: Jetzt erleben wir, dass selbst universitäre Kreise darüber reden, wieviele Jugendliche nicht ans Gymnasium gehören oder wieviele Studierende eine ruhige Kugel schieben. Für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz ist das gefährlich.
Zitiervorschlag
Fleischmann, D. (2022). «Wir bilden die Jugendlichen zu wenig». Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 7(2).