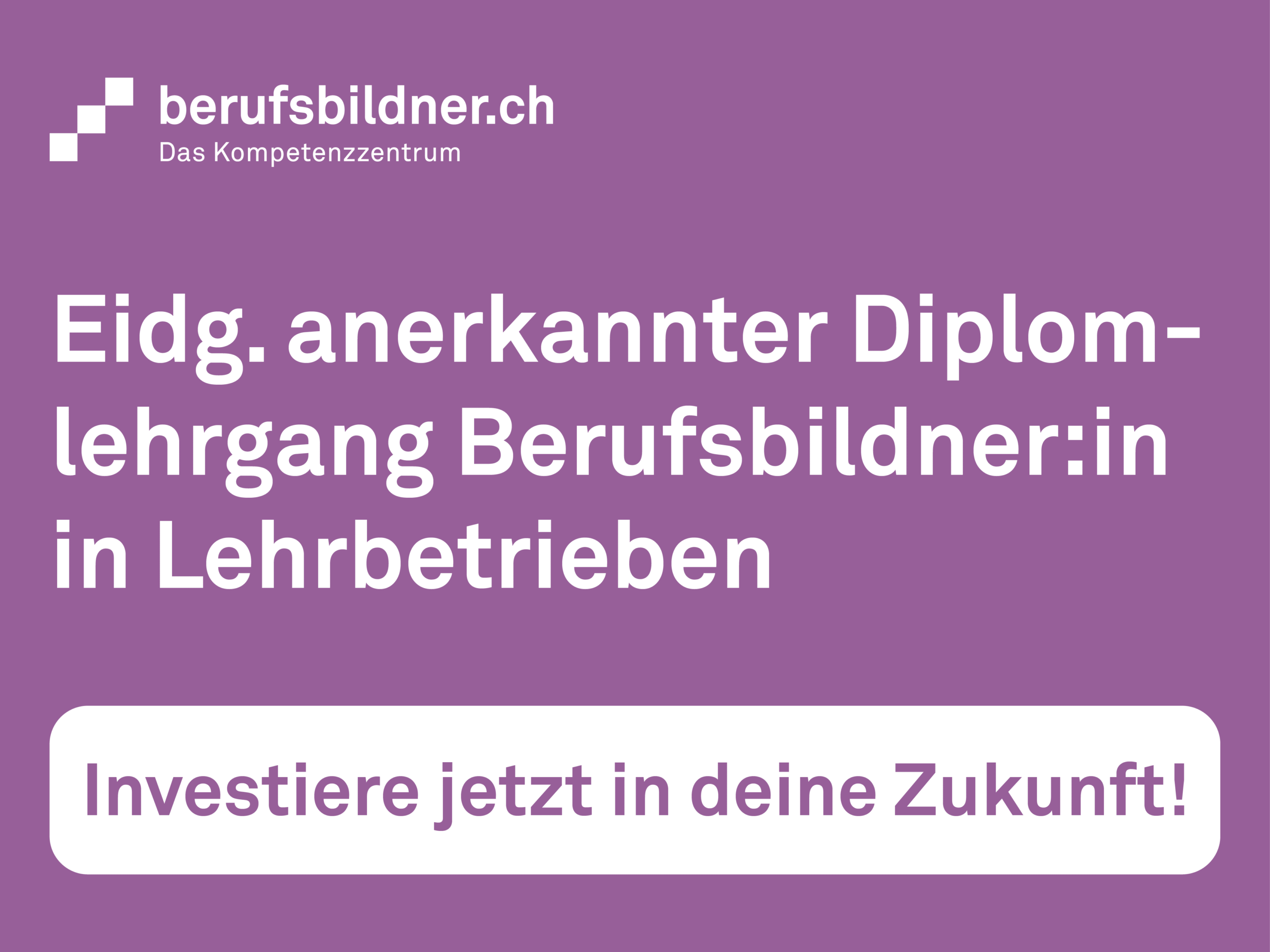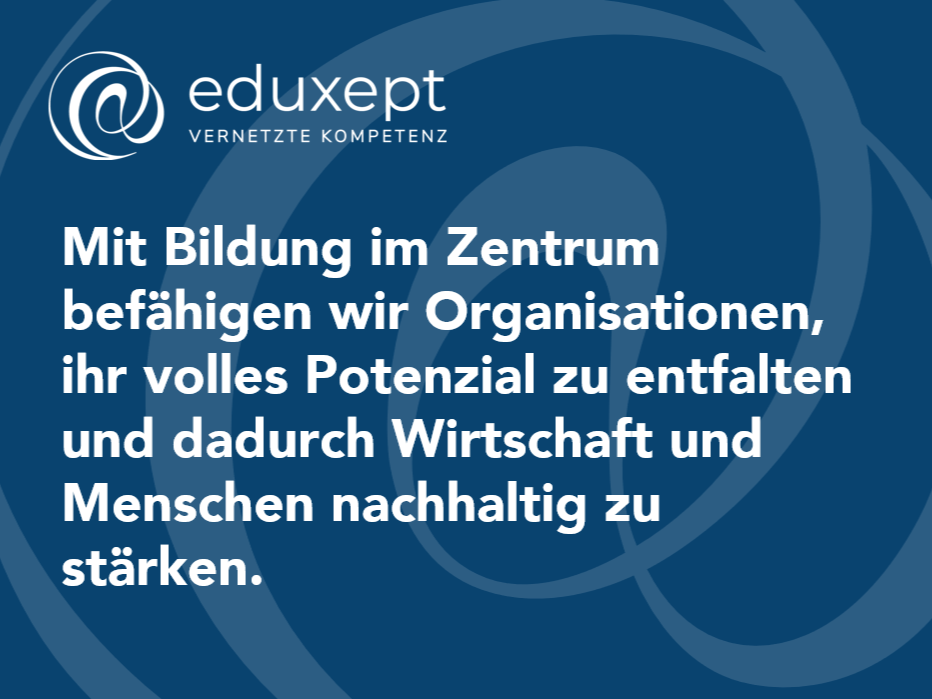Rund die Hälfte aller Lernenden in der Schweiz erwerben in der Berufsfachschule eine Fremdsprache. Manche Lernende sind in ihrem Betrieb mit Fremdsprachen konfrontiert, während andere nur die Landessprache sprechen. Für sie übernimmt die Berufsfachschule eine kompensatorische Funktion. Dabei werden Fremdsprachen nicht mehr primär als eigenes Fach verstanden, sondern als Bestandteil beruflicher Handlungskompetenz. Aber wie gut bewältigen berufskundliche Lehrpersonen diese Aufgabe? Eine Studie der EHB zeigt Chancen und Schwierigkeiten.