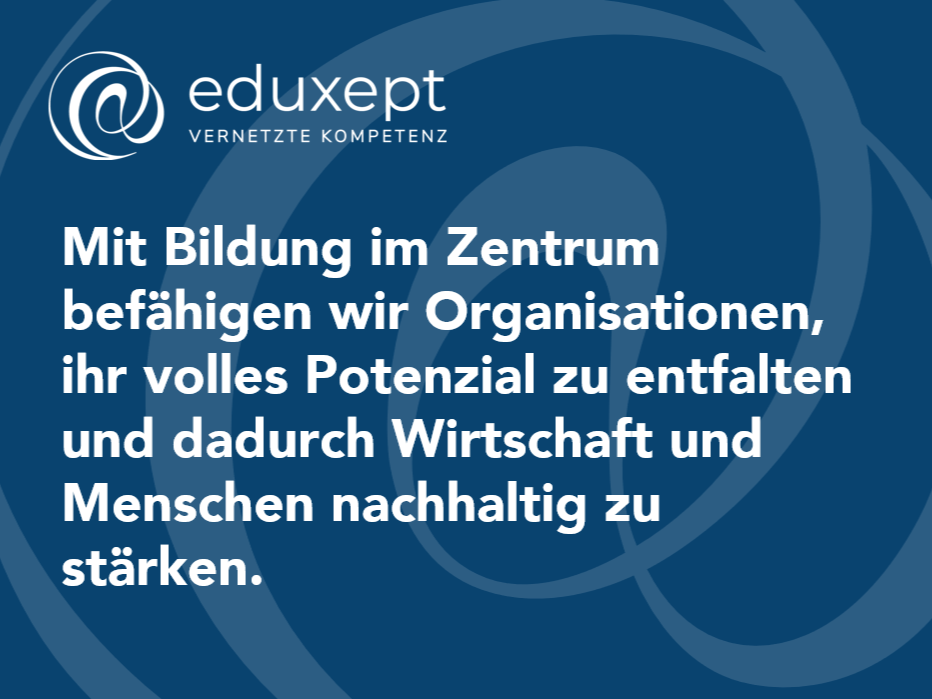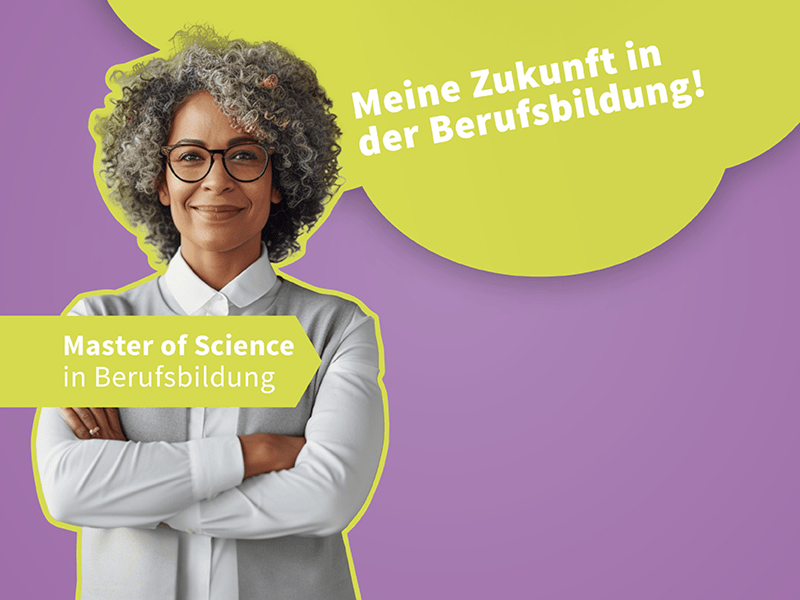Berufsbildung als digitales Handwerk – ein Blick zurück und nach vorn
Robinsonaden des Lernens
Unter dem Titel «Ein Handwerk studieren» hielt Philipp Gonon am 17. Dezember 2020 seine Abschiedsvorlesung an der Universität Zürich. Er blickt darin in die Anfänge der pädagogischen Diskurse im 18. Jahrhundert zurück, als Jean-Jacques Rousseau in der Romanfigur des Robinson Crusoe ein Modell des modernen Lernens erkannte. In seinem Erziehungsroman «Emile» sollte sein Zögling idealerweise das Handwerk eines Tischlers erlernen: Wenn er dies könne, dann würde er sich überall in allen Fachgebieten erfolgreich behaupten können. Dieser Gedanke ist hochmodern: Denn durch die digitalen Werkzeuge sind wir alle wieder auf die Robinsonade des ständigen Lernens geschickt, in dem sich «Hand- und Kopfwerk» verbinden.
Einleitung
Eine handwerkliche Ausbildung war während Jahrhunderten an einen erfahrenen Meister gebunden. Das Vor- und Nachmachen von Tätigkeiten spielte dabei eine wichtige Rolle, damit die «Lehrtochter» oder der «Lehrling» die richtigen Handgriffe erlernte, ausübte und routinisierte. Entscheidend war und ist auch der kundige Gebrauch von Werkzeugen und Arbeitsinstrumenten, ein geübter Umgang mit Materialien und eine Haltung, die als Verbessern durch Pröbeln bezeichnet werden könnte. Wichtig ist ausserdem, dass man durch Beobachtungen lernt und sich von erfahreneren Kolleginnen und Kollegen Ratschläge einholen kann. Ein Handwerk zu erlernen war und ist, einen Sinn für praktikable Lösungen zu entwickeln und Fehler zu vermeiden, all dies eingebettet in eine soziale Praxis.
Eine handwerkliche Ausbildung war während Jahrhunderten an einen erfahrenen Meister gebunden. Dieses Bild erhielt spätestens in den 1970er-Jahren Risse.
Dieses Bild, wie es die auch in den Meisterfamilien beherbergten Jugendlichen seit dem Mittelalter prägte, erhielt spätestens in den 1970er-Jahren Risse. Denn der Erfahrungsvorsprung des Ausbilders schwand, als neue Technologien wie CNC-Maschinen und andere elektronisch und informatik-basierte Werkzeuge an Bedeutung gewannen. Ja, Jugendliche waren häufig besser gerüstet für die neuen Produktionsformen, die vor allem darin bestanden, technische Prozesse zu verstehen und in Werkzeugen und Maschinen eingelagerte Funktionen zu bedienen. Darüber hinaus hatte sich im Verlaufe der Jahrzehnte auch die Rolle des patriarchal geprägten Handwerks in Werkstätten und Betrieben verändert. Lehrlinge waren nicht mehr in Kost und Logis in den Meisterfamilien. Damit entfiel auch die primäre Erziehungsaufgabe des Lehrmeisters: Die väterliche Autorität zerfiel, die Jugendliche oft wie Hausbediente, Mägde und Knechte behandelt und teilweise die eigentliche Ausbildung zur Nebensache gemacht hatte. Die heutige für die Unterweisung der Lernenden zuständige Person im Betrieb ist – so die Norm – ein Lernbegleiter und Arrangeur von Lerngelegenheiten.
«Lehrjahre sind keine Herrenjahre»
Wie schwierig es in vergangenen Zeiten für Lehrlinge war, sich beruflich ausbilden zu lassen, dafür gibt es viele Schilderungen und Zeugnisse. Oft wurden Berufslehren gar nie abgeschlossen, die Lehrvertragsauflösungsquote war dementsprechend hoch. Die bereits in Nachschlagwerken des 19. Jahrhunderts vorfindbare Formel «Lehrjahre sind keine Herrenjahre» wird bis heute noch bemüht, um den Lernenden ihre untergeordnete Rolle zu verdeutlichen. Das erlebte auch ein heute als Schriftsteller, einflussreicher Denker und schon in seiner Zeit prominenter Pädagoge: Jean-Jacques Rousseau.
Die Rousseaus waren schon seit mehreren Generationen in der Uhrenbranche aktiv. In den Museen der Stadt Genf befinden sich von Jean-Jacques Rousseaus Vorfahren verfertigte Uhren. Weniger Spuren finden sich von Isaac Rousseau, seinem Vater, da er – vor der Geburt von Jean-Jacques – eine längere Zeit in Konstantinopel für den Sultan des osmanischen Reiches Uhren in Stand hielt und reparierte, ehe er wieder nach Genf zurückkehrte.
Jean-Jacques Rousseau, der wie sein älterer Bruder eine berufliche Ausbildung begann, kam mit seinem Lehrmeister nicht zurecht.
Jean-Jacques Rousseau, der wie sein älterer Bruder in diesem Metier eine berufliche Ausbildung begann, kam mit seinem Lehrmeister nicht zurecht und schien – so beschreibt er es in seinen Erinnerungen – sich einerseits im Betrieb zu langweilen, andererseits unter den ruppigen Manieren in der Werkstatt zu leiden. Schliesslich kehrte er 1728 nicht nur der Uhrenbranche, sondern auch Genf den Rücken und wurde Schriftsteller in Paris. Die allermeisten Kenntnisse eignete er sich autodidaktisch an, durch das Lesen von Büchern und den Erwerb praktischer Kenntnisse in Musik. Diese biographischen Erfahrungen haben sein Verständnis, wie ein Handwerk zu erlernen sei, geprägt. Mit seinen späteren Veröffentlichungen, insbesondere mit seinem Erziehungsroman «Emile», avancierte Jean-Jacques Rousseau zu einem Klassiker der Pädagogik. In dieser Veröffentlichung spielt das Handwerk eine besondere Rolle.
Pädagogische Klassiker und das Handwerk: Rousseaus Emile und das Handwerk
Der bildende Beitrag des Handwerks für die Erziehung und der grosse Nutzen für das Hineinwachsen in eine Gesellschaft der Erwachsenen wurde auch von anderen Pädagogen hervorgehoben. John Locke, auf den sich Rousseau bezieht, hatte in seinen «Gedanken über Erziehung» (1693) eine Reihe von Fertigkeiten aufgeführt, die zu erlernen seien: Zeichnen, Malen, Musizieren, Fechten und Reiten. Obwohl – seinen Überlegungen gemäss – Erziehung im Hinblick auf die künftigen Geschäfte eines Mannes von Stande der Hauptzweck seien, wünsche er dennoch, dass der zu Erziehende eine «mechanische Arbeit, ein wirkliches Handwerk, ja sogar zwei oder drei, aber eines vorzüglich» zu erlernen habe. Nicht nur Sprache und Wissenschaften seien es wert, erlernt zu werden, sondern auch die Gartenarbeiten, die Kunst des Drechselns und das Härten von Eisen sowie dessen Verarbeitung. Es ging ihm hierbei nicht nur darum, Erziehung und Unterricht abwechslungsreicher und vergnüglicher zu machen, sondern auch für «eine gesunde Seele in einem gesunden Leibe» nützliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln.
Robinson gestaltet sein Leben auf der einsamen Insel, indem er sich mit Werkzeugen die notwendigen Gegenstände selbst erschafft.
Ausführlicher waren die Überlegungen von Jean-Jacques Rousseau zu diesem Thema. In seinem Erziehungsroman «Emile» soll sein Zögling idealerweise das Handwerk eines Tischlers erlernen. Wenn sie dies könne, dann würde sich eine so gebildete Person überall in allen Fachgebieten erfolgreich behaupten können, nicht nur im Handwerk, sondern auch in allen wissenschaftlichen Gebieten – so sahen es Rousseau, aber ebenso die Pädagogen, die sein Werk in das erste grössere pädagogische Nachschlagwerk übersetzten und ihn im deutschen Sprachraum verbreiteten, z.B. Johann Heinrich Campe und dann Pestalozzi. Für Rousseau war neben dieser klaren Präferenz für Holzarbeiten ebenso das selbständige Erlernen eines Handwerks wichtig. Der Erzieher war bei ihm eher im Hintergrund und beratend vorgesehen, er sollte mit Emile zusammen ein Handwerk erlernen. Rousseaus Modell war hierbei aus der – neben der Bibel meist verbreiteten – Veröffentlichung entnommen: «Robinson Crusoe» von Daniel Defoe. Die Hauptfigur Robinson gestaltet sein Leben auf der einsamen Insel, indem er sich mit Werkzeugen die notwendigen Gegenstände selbst erschafft. Auf diese Weise wird er unabhängig in seiner Lebensführung. Durch ein solch selbständiges Lernen mit seinen Händen und mit Werkzeugen wird er eine Persönlichkeit, die nicht von den Zwängen der Umgebung und den (Vor-)Urteilen anderer abhängig ist. Ein solch pädagogisch verstandener Robinson inspirierte auch spätere Erziehungsratgeber und Lehrpläne, im Sinne einer Welterschliessung durch ein «lerne ein Handwerk gründlich und eigenständig» – ein Anspruch, den später ein anderer berühmter Autodidakt, Johann Wolfgang Goethe, so formulierte.
Die Verschulung der Berufsbildung oder der «goldene Boden» des Handwerks
In den folgenden Jahrzehnten fanden pädagogische Überlegungen zu Erziehung und Bildung von Lernenden in Handwerk und Gesellschaft vermehrt Aufmerksamkeit. In der Volksschule wurden manuelle Arbeiten und Tätigkeiten als Bestandteil der Erziehung und Bildung eingeführt, als Vorbereitung auf das spätere Arbeitsleben oder speziell für junge Frauen im Hinblick auf das Leben im Haushalt, aber auch als genuines Bildungsinstrument.
Weiter ergab sich im 19. Jahrhundert eine Institutionalisierung beruflicher Bildung im Anschluss an die Volksschulbildung. Nicht nur der durch einen Hauslehrer wie bei John Locke unterwiesene oder der fern der Gesellschaft aufwachsende Jugendliche wurde in handwerkliche Tätigkeiten eingeführt, sondern auch diejenigen, die tatsächlich in einer Werkstätte tätig waren.
Mit zunehmender Industrialisierung gerieten die meist auf handwerklicher Basis betriebenen KMU allerdings in eine Krise. Sie wurden von der Industrie überflügelt, die mit moderner Technik, insbesondere Maschinen, mehr, kostengünstigere und oft sogar bessere Produkte erzielte. Zur Erneuerung der Klein- und Mittelbetriebe und des Handwerks wurde auf Bildung gesetzt, und zwar ergänzend zu schulischer Bildung. Zeichnen als Fach und ein Fortbildungsunterricht sollten die Qualität des Handwerks heben und es international konkurrenzfähig machen.
Der Volksschriftsteller Heinrich Zschokke formulierte 1845, den Satz, dass das Handwerk dann «goldenen Boden» habe, wenn «Hand- und Kopfwerk» zusammenkämen.
Der Volksschriftsteller Heinrich Zschokke formulierte zu Zeiten der Begründung des Bundesstaates, genauer 1845, den Satz, dass das Handwerk dann «goldenen Boden» habe, wenn «Hand- und Kopfwerk» zusammenkämen; daher seien Gewerbe- bzw. Berufsschulen zu schaffen. Nur so sei man auch gegenüber der englischen (Textil-)Industrie konkurrenzfähig.
Vom gestrengen Lehrmeister zum Lerncoach
Das handwerkliche Modell des Lernens im Betrieb gepaart mit Schulbildung erfasste in der Folge die gesamte Arbeitswelt, also ebenso Landwirtschaft, Dienstleistungen, Handel und Industrie. In den Jahrzehnten darauf veränderte ein weiterer Aspekt die Ausbildung im Betrieb. Einerseits setzte sich die berufliche Bildung, so im 20. Jahrhundert, immer mehr als «Normalfall» im Anschluss an die Volksschule durch. Andererseits stiegen damit die Erwartungen, dass nicht nur produktiv gearbeitet und für den Beruf erzogen werde. Es sollten Qualifikationen für die unmittelbare Arbeitstätigkeit, aber auch solche für das spätere Leben im Beruf erlernt werden. Der Anspruch Jugendlicher (und ihrer Eltern), nicht nur etwas Handfestes zu erlernen, sondern auch Kenntnisse vermittelt zu bekommen, die für ihr berufliches Fortkommen nützlich sind, erhöhte die Nachfrage nach Bildung und Schule weit über das Kindesalter hinaus. In den 1960er-Jahren wurde die Jugendzeit nicht mehr ausschliesslich als Einstieg in die Arbeitswelt verstanden, sondern immer stärker auch als Zeit der (Aus-)Bildung. Der Inhaber einer Werkstätte und Unterweiser verlor damit seine herausragende Rolle, Jugendliche zu beschäftigen und zu erziehen. Noch in den 1968er-Jahren und danach richteten sich die Studenten- und Lehrlingsproteste nicht nur gegen die Bildungsbenachteiligung von Lernenden in Klein- und Mittelbetrieben im Vergleich zu den Gymnasien, sondern ebenso gegen den «autoritären Meister».
Gleichzeitig veränderten die eingesetzten neuen Technologien in den Unternehmen die manuelle Arbeit. Die langjährige Erfahrung der Ausbilder verlor an Bedeutung gegenüber sich ständig wandelnden Produktionsbedingungen. Die Berufsbildung in einem computerisierten Umfeld untergrub den Wissen- und Erfahrungsvorsprung des Ausbilders und versetzte Lehrmeister und Lernende in die gleiche Situation: Neues unmittelbar vor Ort zu erlernen. Damit verändert sich auch ihre Rolle als Unterweiser. Sie wurden hiermit – idealerweise – eher Arrangeure von Lerngelegenheiten und begleiten bzw. «coachen» die Jugendlichen.
Erfinderischer Empirismus oder die digitale Lernerin als Autodidaktin
Die Lernenden im Betrieb sind auch in KMU ständigen Innovationen ausgesetzt und müssen – wie die Ausbildner auch – stetig Neues lernen.
In gewisser Weise wiederholt sich damit die Situation, die Jean Jacques Rousseau für Emile beschrieb und die er mit seiner pädagogischen Robinsonade anstrebte. Die Lernenden im Betrieb sind auch in KMU ständigen Innovationen ausgesetzt und müssen – wie die Ausbildner auch – stetig Neues lernen. Sie können sich nur teilweise noch auf gemachte Erfahrungen verlassen und müssen selbständig Wissen und Fertigkeiten aneignen. Dies gilt im Besonderen für die digitale Arbeitsumgebung. Gefragt und erforderlich sind nicht nur kommunikative Fähigkeiten und das Verstehen technischer Prozesse. Gerade in der heutigen digitalisierten Arbeitswelt ist ein empirisch-theoretischer Lernstil bedeutsam. Vieles wird nicht über die Schulfächer oder den Lehrmeister vermittelt, sondern muss selbst erprobt werden. Gefragt ist, dem Robinson nicht unähnlich, ein erfinderischer Empirismus (Gaston Bachelard), um im digitalen Eiland zu bestehen.
Ganz im Sinne von Rousseaus pädagogischem Robinson werden die Lernenden künftig vieles neu situationsbezogen erlernen müssen: unmittelbare Problemlösungen im Betrieb ebenso wie Kenntnisse, die man in Weiterbildungskursen, in der Höheren Berufsbildung oder an Fachhochschulen erwirbt. Die handwerklich-berufliche und digitale Lernerin wird künftig weitgehend vieles autodidaktisch, das heisst selbstorganisiert in praktischer Tätigkeit erlernen und dies mit Selbststudium und Studium verbinden, um sich für eine globale Dienstleistungsgesellschaft und die «Knowledge Economy» zu bilden.
Dieser Text bildet die durch Philipp Gonon erstellte Kurzfassung seiner Abschiesvorlesung als Professor für Berufsbildung an der Universität Zürich. Die Vorlesung mit dem Titel «Ein Handwerk studieren. Die Zukunft der Bildung in der Schweiz» fand wegen Corona ohne Publikum vor Ort statt. Eine Videoaufnahme der Rede finden Sie im Internet. Eine Würdigung von Philipp Gonon hielten unter anderem André Schläfli, langjähriger Direktor des SVEB (Schweizerischer Verband für Weiterbildung) sowie Thomas Deißinger, Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität Konstanz. Diese Redetexte finden Sie hier.
Zur Professur von Philipp Gonon
2004 hat die Universität Zürich einen Lehrstuhl für Berufsbildung geschaffen und ihn mit Philipp Gonon besetzt. Gonon war zum damaligen Zeitpunkt als Professor für berufliche, betriebliche Weiterbildung an der Universität Trier tätig und konnte seine Eignung auch mit Hinweis auf seine Habilitation (eine vergleichende Studie zu bildungspolitischen Diskursen in England und der Schweiz), seine Dissertation (Arbeitsschule) und seine Lizenziatsarbeit (Lehrwerkstätten) belegen. Seinen Forschungsschwerpunkt bildet heute – wie es sich schon in den erwähnten Arbeiten Gonons abgezeichnet hatte – die Auseinandersetzung mit der Genese beruflicher Bildung in der Schweiz. Weitere Aktivitäten Gonons sind international vergleichende Arbeiten im Bereich Qualitätssicherung und Evaluation. Bildungspolitische Verdienste erwarb sich Philipp Gonon mit der Auseinandersetzung mit der informellen Weiterbildung zu einem Zeitpunkt, als dieser Bereich weder gesetzlich geregelt war noch von den Trägern der Berufsbildung in ihrer Bedeutung wahrgenommen wurde. Gonon verfasste gleich mehrere Studien zu diesem Thema. So ist es wohl kein Zufall, dass an der Emeritierungsfeier am 22. Januar 2021 unter anderem André Schläfli sprach. Schläfli war langjähriger Direktor des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung (SVEB). Die Nachfolge von Philipp Gonon tritt Katrin Kraus am 1. Mai 2021 an. Ihr Lehrstuhl heisst dann «Berufs- und Weiterbildung».
Daniel Fleischmann, Transfer
Zitiervorschlag
Gonon, P. (2021). Robinsonaden des Lernens. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 6 (2).