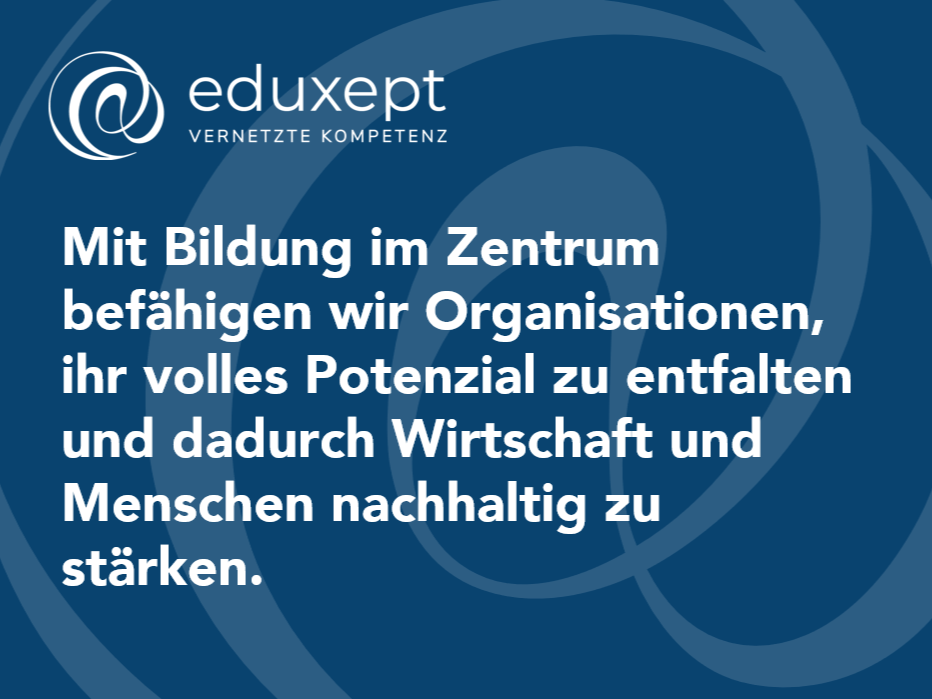EHB-Workshop zu den Herausforderungen der Berufsbildung
Qualität! Ziel oder Slogan für die Berufsbildung?
Der Winterworkshop der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB) bringt jedes Jahr Expertinnen, Forschende und Praktiker aus der Berufsbildung zusammen, um aktuelle Herausforderungen und Fragestellungen zu diskutieren. Die Ausgabe 2025 widmete sich einer besonders brisanten Frage: Ist Qualität in der Berufsbildung ein greifbares Ziel oder lediglich ein Schlagwort? Eines der Ergebnisse: Qualität sollte nicht als starres Raster gedacht, sondern als Aushandlungsprozess und kontinuierliche Reflexion über Bildungsziele und die Rollen der unterschiedlichen Akteure verstanden werden.
Ein Begriff mit vielen Gesichtern
Qualität ist stets abhängig vom jeweiligen Kontext und von den Zielsetzungen und Bedürfnissen der beteiligten Akteurinnen und Akteure.
Qualität ist ein überaus komplexer Begriff: vieldeutig, abstrakt, konzeptionell schwer zu fassen – und dennoch in der Wirtschaft, der Verwaltung, der Wissenschaft oder der Bildung eine zentrale Referenz. Je nach Perspektive kann Qualität begriffen werden
- als Ideal, das angestrebt, aber nie vollständig erreicht werden kann, oder
- als messbares Ergebnis, das die Übereinstimmung zwischen gesetzten Zielen und tatsächlichen Ergebnissen abbildet.
Aufgrund dieser Vielschichtigkeit scheint eine einheitliche Definition von Qualität kaum realisierbar. Umso wichtiger ist es, unterschiedliche Verständnisse von Qualität sichtbar zu machen, ihre Kontexte zu analysieren und – wo das möglich ist – gemeinsame Nenner zu identifizieren. Denn Qualität ist stets abhängig vom jeweiligen Kontext und von den Zielsetzungen und Bedürfnissen der beteiligten Akteurinnen und Akteure.
Auch im Bildungsbereich – sei es in der schulischen, hochschulischen oder beruflichen Bildung – stellt sich die Frage nach Qualität in vielfältiger Weise. Seit über zwei Jahrzehnen ist das Versprechen von Qualität in der Bildung präsent, oft verbunden mit dem Anspruch auf Steuerung, Evaluation und Verbesserung. Qualität wird dabei nicht nur mit Exzellenz oder Innovation assoziiert, sondern auch mit Transparenz, Vergleichbarkeit und Rechenschaftspflicht. In Gesetzestexten, Strategien und Evaluationsinstrumenten nimmt der Qualitätsbegriff einen zentralen Platz ein, ohne jedoch abschliessend geklärt zu sein. Die Herausforderung besteht darin unterschiedliche Qualitätsansprüche zwischen pädagogischen Praktiken und bildungspolitischen Zielen in Einklang zu bringen.
Qualität ist nicht zuletzt in der Berufsbildung ein zentrales Thema – und gleichzeitig ein umkämpftes Feld. Das Berufsbildungsgesetz widmet der Qualitätsentwicklung und der Sicherstellung von Qualitätsstandards einen eigenen Paragrafen. Unterschiedliche Akteure – von Bund und Kantonen über Berufsverbände bis hin zu Ausbildungsbetrieben und Bildungsinstitutionen – tragen subsidiär Verantwortung für die Qualität in der beruflichen Grundbildung, der Höheren Berufsbildung, der Weiterbildung und der Berufsbildungsforschung. Dabei treffen unterschiedliche Verständnisse und Interessen aufeinander: Für Politik und Verwaltung sind mess- und vergleichbare Kriterien wie Erfolgsquoten bei Qualifikationsverfahren oder die Höhe der Jugendarbeitslosigkeit interessant. Ausbildungsbetriebe sehen Qualität der Berufsbildung mitunter darin, wie gut die Lernenden den produktiven betrieblichen Anforderungen entsprechen. Aus Sicht der Lernenden bedeutet Qualität unter anderem Begleitung, Anerkennung und Entwicklungsperspektiven. Das wirft zentrale Fragen auf: Lassen sich diese Sichtweisen in einem gemeinsamen Rahmen vereinen? Und welche Auffassung von Qualität sollte Vorrang haben?
Qualität als Aushandlungsprozess
Die Diskussionen im Winterworkshop zeigten die vielen Facetten des Qualitätsbegriffs und machten den Blick auf unterschiedliche Ansätze frei.
Daraus entstehe jedoch ein Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Zielen (qualifizierte, produktive Arbeitskräfte) und sozialen Zielen (möglichst breite Inklusion) der Berufsbildung.
Giuliano Bonoli (Universität Lausanne) betonte, dass die Berufsbildung ein zentraler Bestandteil der national jeweils unterschiedlichen Sozialpolitik ist. Daraus entstehe jedoch ein Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Zielen (qualifizierte, produktive Arbeitskräfte) und sozialen Zielen (möglichst breite Inklusion) der Berufsbildung. Die Qualität eines Berufsbildungssystems könnte, so sein Vorschlag, daran gemessen werden, wie gut es diese beiden Ziele ausbalanciert. Um die Attraktivität und die Inklusionsfähigkeit der Berufsbildung zu verbinden, sind in kollektiven Berufsbildungssystemen Massnahmen erfolgsversprechend, die entweder die Betriebe nicht unmittelbar tangieren (z.B. ein 10. Schuljahr) oder unmittelbaren Bedürfnissen der Betriebe entsprechen (z.B. Integrationsmassnahmen in Berufen mit Fachkräftemangel).
Sandra Hupka-Brunner (Universität Bern) betrachtete das Thema aus bildungssoziologischer Sicht und fragte, mit welchen Indikatoren die politischen Bildungsziele evaluiert werden können, um die Qualität der Berufsbildung in der Schweiz zu beurteilen. Sie führte aus, dass wir bereits über eine umfangreiche Datengrundlage verfügen, die Auswahl der Qualitätskriterien aber keinesfalls trivial sei: Betrachten wir Qualität entlang der Erfassung von Durchlässigkeit des Bildungssystems, des Return on Investments in Bildungsgänge, der Kompetenzentwicklung oder der Weiterbildungs- und Laufbahnaktivität? Auf Basis der Daten der Schweizer Langzeitstudie TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) argumentierte Hupka-Brunner, dass für die Beurteilung von Qualität nicht nur die theoretisch möglichen Wege innerhalb eines Bildungssystems, sondern auch die effektiv begangenen (und nicht begangenen) Laufbahnen berücksichtigt werden müssten.
Mit einem kritischen Blick auf die wissenschaftstheoretischen Grundlagen unseres Qualitätsverständnisses machte Jürg Schweri (EHB) die Anwesenden auf mögliche Widersprüche in unseren Vorstellungen von Qualität in der Berufsbildung aufmerksam. Während gewisse Aspekte von Qualität mit wissenschaftlicher Strenge erhoben werden können, bleibe deren (politische) Interpretation nie frei von normativen Voraussetzungen. Im Sinne einer gängigen Differenzierung von Qualität können wir zwar Input, Prozess und Output faktenbasiert beschreiben. Welche Ziele hingegen erreicht werden sollen – und darin liegt im Kern die Definition von Qualität – das bleibe eine normative Aufgabe. Für die Forschung und mögliche Erwartungen aus der Politik an Forschungsergebnisse lasse sich daraus schliessen, dass die Qualität der Forschung selbst nur sichergestellt werden kann, wenn sie die Grenzen der eigenen Fähigkeiten kennt und mögliche Massnahmen für die Entwicklung der (zukünftigen) Qualität ihres Gegenstandes – hier der Berufsbildung – mit einer gewissen Bescheidenheit kommuniziert (oder vertritt).
Kerstin Duemmler (EHB) betrachtete Qualität der Berufsbildung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit – und vice versa die Qualität der Nachhaltigkeit. Genauso wie Qualität ist auch Nachhaltigkeit in der Berufsbildung seit mehr als 20 Jahren gesetzlich als Ziel verankert. Aber beide basierten auf schwer fassbaren, schillernden und doch omnipräsenten Konzepten. Trotzdem gilt Nachhaltigkeit (noch) nicht als zentrales Element unserer Vorstellungen von Qualität in der Berufsbildung. Dies mag wiederum mit der Qualität unseres Verständnisses von Nachhaltigkeit in der Berufsbildung zu tun haben: In der Schweiz stehen wir erst am Anfang einer differenzierten Diskussion, was Nachhaltigkeit für die Berufsbildung bedeuten könnte.
Eine sehr enge Vorstellung von Qualität entlang standardisierter und output-bezogener Indikatoren sei im Rahmen des diskursiv immer wieder neu ausgehandelten und teilweise widersprüchlichen Qualitätsverständnisses nicht angebracht.
In seinem Tagesfazit betonte Jakob Kost (PHBern), dass Qualität ein Konzept bleiben muss, um die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems – und damit zwischen Forschung und Politik – zu rahmen. Der Wunsch nach einer einheitlichen und abschliessenden Definition von Qualität sei verschwendete Zeit, wenn wir nicht den Aushandlungsprozess selbst als Ziel verstehen. In diesem Sinne brauche die Berufsbildung in der Schweiz auch keine Befürchtungen vor einem «Qualitätstribunal» zu haben. Eine sehr enge Vorstellung von Qualität entlang standardisierter und output-bezogener Indikatoren sei im Rahmen des diskursiv immer wieder neu ausgehandelten und teilweise widersprüchlichen Qualitätsverständnisses nicht angebracht. Dies zeige sich über alle Beiträge des Winterworkshops: Die Berufsbildung und deren Qualität gingen weit über Vermittlung von Qualifikationen und der Befähigung für den Arbeitsmarkt hinaus. Sie erfülle eine soziale Funktion, wirke als Lebensraum, Impulsgeberin für soziale, politische und wirtschaftliche Innovationen und spiele eine zentrale Rolle in der Zivilgesellschaft. Diese pluralen Zielen der Berufsbildung müssen mit unseren Qualitätsvorstellungen vereinbar sein. Qualität sollte nicht als starres Raster gedacht, sondern als Aushandlungsprozess und kontinuierliche Reflexion über Bildungsziele und die Rollen der unterschiedlichen Akteure verstanden werden. Die Beiträge und Diskussionen des Workshops erweiterten den Diskurs über Qualität – und machten genau diese Komplexität deutlich.
Fazit: Qualität als gemeinschaftliches Projekt
Qualität in der Berufsbildung darf nicht auf ein blosses Schlagwort reduziert werden. Sie ist tatsächlich mehr Ziel als Slogan. Die Definition von Qualität und die Umsetzung von Massnahmen zu ihrer Stärkung bleiben jedoch eine immerwährende Aufgabe. Die Vielfalt an Blickwinkeln und Bedürfnissen erfordert eine Herangehensweise, die interdisziplinäre Perspektiven aus der Forschung mit normativen Forderungen aus der Politik und anwendungsorientieren Bedürfnissen aus der Praxis integrieren kann. Qualität ist kein statischer Begriff, sondern muss ständig hinterfragt und gemeinsam (weiter)entwickelt werden.
Der Winterworkshop hat diesen Dialog aufgenommen. Es wurde vor allem diskutiert, inwiefern die Berufsbildungsforschung in der Lage ist, ein gemeinsames Narrativ zur Qualität zu entwickeln oder zumindest eine kohärente Verbindung der verschiedenen disziplinären Sichtweisen. Das ist in vielerlei Hinsicht eine notwendige Voraussetzung, um konkrete Schritte zur Verbesserung der Qualität in der Berufsbildung anzustossen. Dass dabei im Rahmen eines interdisziplinären Austausches einige Fragen offenbleiben, ist erwartbar. Genauso klar geworden ist hingegen, dass Forschung und Wissenschaft Massnahmen zur Steigerung von Qualität zurückhaltend beurteilen sollten. Dies aus erkenntnistheoretischen Gründen, aber auch, weil unsere Vorstellungen von Qualität ganz eng mit normativen Zielen verbunden sind. In diesem Sinne zeugte der Winterworkshop von einer hohen Qualität des Diskurses um die Möglichkeiten und Grenzen unseres Verständnisses von «Qualität» in der Berufsbildung.
Im kommenden Winterworkshop Anfang 2026 diskutieren wir über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Berufsbildung. Die Einladung wird im Herbst publiziert. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Zitiervorschlag
Wenger, M., Ruoss, T., & Bonoli, L. (2025). Qualität! Ziel oder Slogan für die Berufsbildung?. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (7).