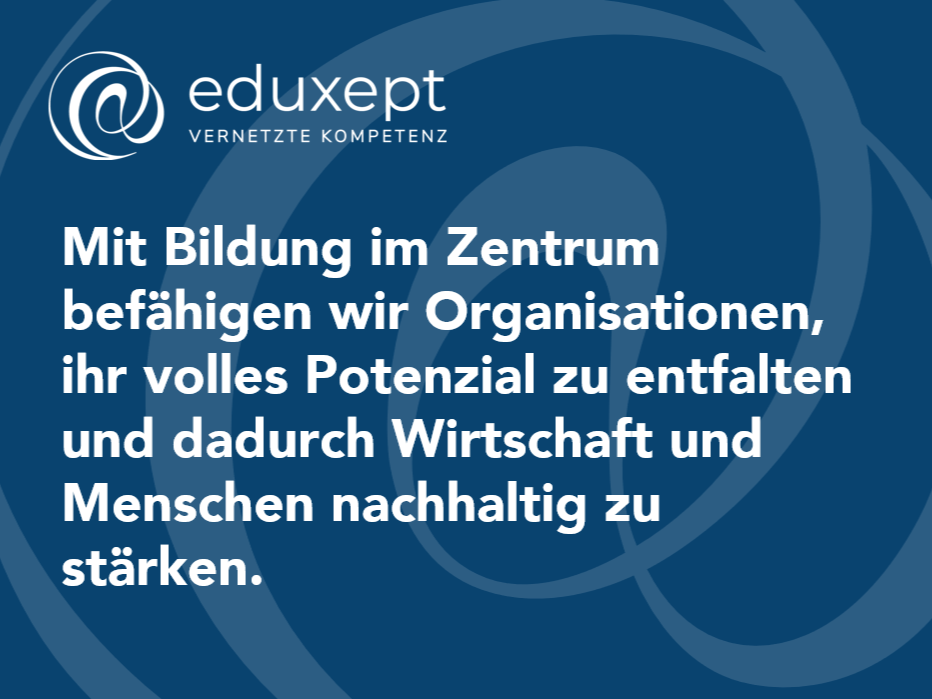Die Digitalisierung hat die Arbeit in den Spitälern stark verändert. Informationsweitergabe und Kommunikation erfolgen zunehmend über Gesundheitsinformationstechnologien wie klinische Informationssysteme. Dafür müssen sowohl das ärztliche Personal als auch das Pflegepersonal entsprechend ausgebildet sein – unzureichende Kompetenzen in der digitalen Kommunikation können die Kontinuität der Patientenversorgung gefährden. Ein Forschungsprojekt der EHB identifizierte 27 situierte digitale Kompetenzen für Pflegefachpersonen bei der Informationsweitergabe. Die Erkenntnisse sind bereits in einen Multimedia-Prototypen sowie in textbasierte Lernsituationen für die Aus- und Weiterbildung eingeflossen.