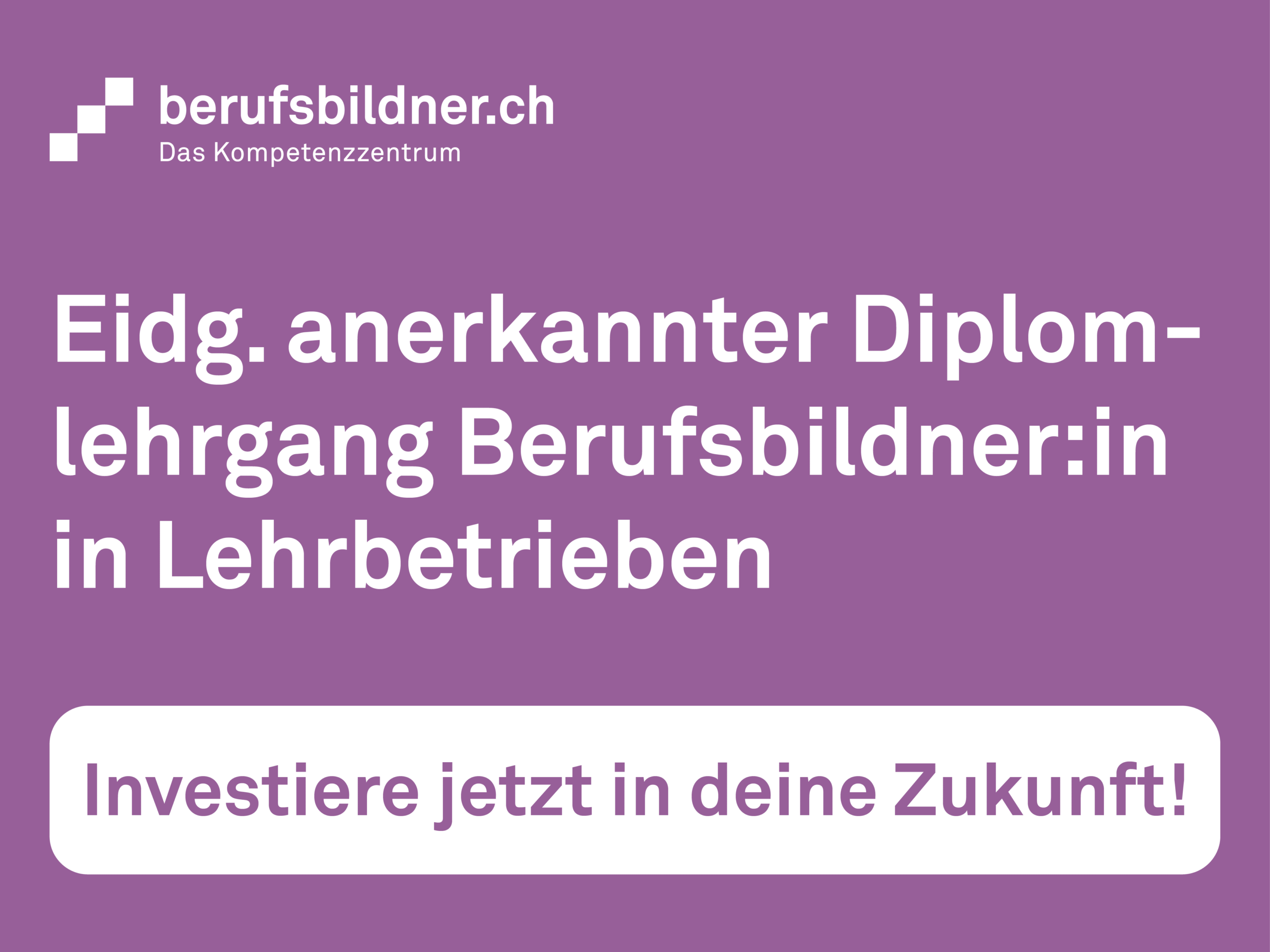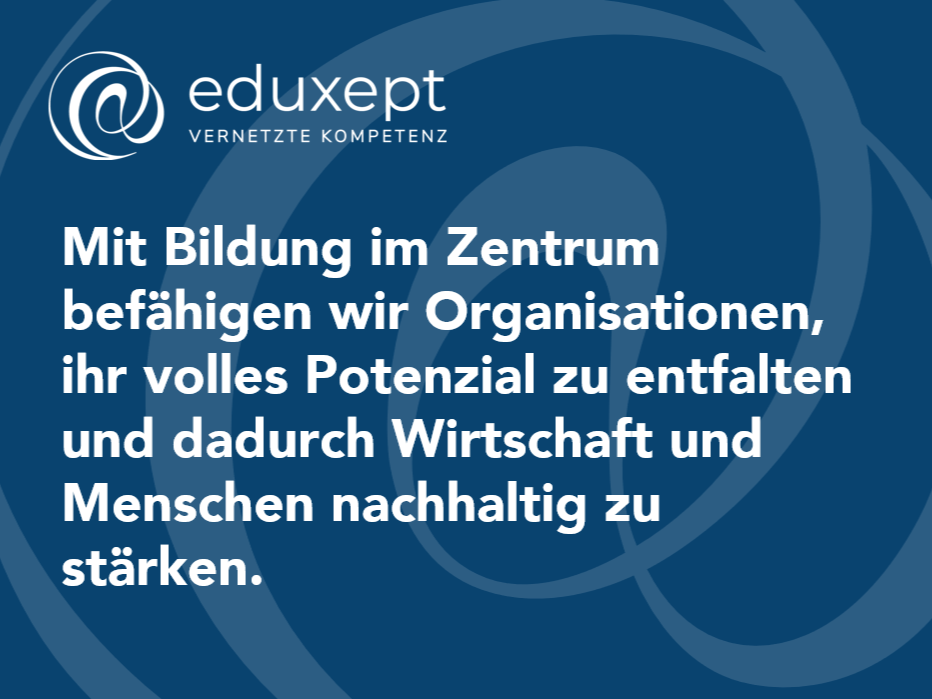Jugendliche in der beruflichen Bildung kümmern sich weniger um Politik als ihre Altersgenossen in der Allgemeinbildung (Gymnasium). Ist dies als Desinteresse zu verstehen? Die vorliegende Studie zeigt ein anderes Bild: Viele Lernende haben das Gefühl, aufgrund ihres Alters und des geringeren Stellenwerts ihrer Ausbildung nicht ernst genommen zu werden. Sie empfinden die Politik als einen distanzierten und kodifizierten Ort, der denjenigen vorbehalten ist, die über mehr Ressourcen oder einen akademischeren Hintergrund verfügen. Sie sind der Meinung, dass ihre Erfahrungen aus der Praxis und ihre praktischen Kompetenzen selten berücksichtigt werden.